


Meistens wird angenommen, Bilder, die auf der perspektivischen Abbildung
beruhen, gäben genau dasjenige zu erkennen, was auf ihnen abgebildet
ist: ein Haus würde also als Haus wahrgenommen, ein Stuhl als Stuhl,
ein Fluß als Fluß. Das ist so naheliegend, daß man es
kaum hinterfragt findet - schließlich ist ja Ziel der perspektivischen
Abbildung, genau diese Identität zu erreichen. Tatsächlich ist
diese Annahme reichlich verwegen. Schon ein flüchtiger Blick auf Giovanni
Bellinis "Madonna von der Wiese" verrät, daß es sich
bei dem Abgebildeten nicht bloß um eine Mutter mit Kind in einer irgendwie
interessanten Landschaft handelt: seine Teile scheinen für mehr zu
stehen, für Lebenserfahrungen vielleicht oder andere von uns gewöhnlich
nicht benennbare Resonanzen. Ein Haus ist jedenfalls nicht nur Haus, ein
Baum nicht Baum, eine Mutter keine Mutter. Worum handelt es sich also bei
diesem Mehr, das Bilder enthalten - Was eigentlich sehen wir in Bildern?
Die meisten Madonnenbilder sind zunächst einmal als Illustration
der christlichen Grunderfahrung begreifbar: daß erstens die Menschen
trauriger sind, als man denkt - deutlich im Gesichtsausdruck Marias zu erkennen,
deren Vorwissen um den Tod ihres Sohns christliches Mutterglück 1000
Jahre überlagern wird - und zweitens, auch das ist ja nicht ganz unbekannt
geblieben: gibt es gar keine Erwachsenen - das lenkt unser Interesse auf
den kleinen Jesus, in dem, oder genauer: in dessen in Marias Muttergriff
Gehalten-werden, sich wohl noch jeder Mann wiederzuentdecken vermag. Auf
jeden Fall aber beginnt die Geschichte eines Mannes mit dem Abschied von
seiner Mutter, und ein solcher Abschied soll den Filmteil dieses Aufsatzes
einleiten.
 |
 |
Hier sind sie also, die Hauptpersonen des Films, gerade noch hatten sie
hilflos versucht, ein Liebespaar zu sein - - jetzt trennen sie sich; und
schon sitzt sie da, die weibliche Hauptdarstellerin, auf einer Sandbank
am Rand eines warmen Korallenmeers, nunmehr allein: 'Wird schon sehen, was
sie davon hat, ihren Sohn so davongehen zu lassen!' denkt bockig der junge
Mann, für den sie, wo er sich von ihr trennen will, auf einmal Mutter
geworden ist - denn nun geht es, wie der erklingende Kommentar verrät:
'hinaus in die fremde ferne Welt.' Und so sitzt sie da bis zur Abblende,
diese nichtsahnend zur Mutter Gewordene - Robert, ab jetzt einziger
 |
 |
Held des Films, wird sie nie wiedersehen. Er hat nämlich einen Weg
entdeckt, dem er folgen, auf dem er sich finden will, dieser Held, der noch
nicht weiß, daß die folgende Sequenz 'Der Weg stirbt!' heißen
wird. Als Zuschauer ahnen wir dies schon, denn wo er gehen will, öffnet
sich gar kein Weg, stattdessen stapft man in hüfthohes Wasser - da
verliert der Film, weil der Ton nun ausblendet, seine selbstbewußt
realistische Oberfläche und wird ganz still.

In einer Nahaufnahme zerspült eine Welle die Werkzeuge, zart und
in sachtem Schwung, mit Hilfe derer die beiden so mutig ihr Überleben
haben sichern wollen - sie erinnern, schon weil die irreale Stille von Traum
oder Erinnerung spricht, an das längst vergessene Spielzeug unserer
Kindheit. Und nachdem sich Robert in Form einer Abblende auch von ihm verabschiedet
hat, durchwatet er dies Meer aus mütterlicher Wärme, das seine
Bewegungen umschmeichelnd hemmt, und an dessen Ende für niemanden ein
begreifbares Ziel zu erkennen ist. Doch nun beendet Musik die Irrealität
dieser Stille, und mit ihr erscheinen die Bilder, die einem nach der Trennung
von zu Haus begegnen; da sehen wir sie endlich, die uns Versprochene: die
ferne fremde Welt.

Eigensinnig beginnt sie an der Hafeneinfahrt von Liverpool, die Sie hier
sehen können, und nur exzentrische Literaturwissenschaftler werden
interessant finden, daß Redburn diesen Ort einmal passiert haben muß,
der Schiffsjungenheld aus Melvilles gleichnamigen Jugendroman; und sechzehn
Jahre nach dem Erscheinen "Redburns" auch sein am Schreiben von
"Pierre" und dem "Confidence-Man" müde gewordener,
an den Nerven beschädigter Autor, mit dem Schraubendampfer 'Egyptian'
auf dem Weg nach Konstantinopel, von wo es ihn via Ägypten nach Jerusalem
zog - manche meinen, Grund seiner Müdigkeit wäre seine ihn verbitternde
Erfolglosigkeit. 'Exzentrischer Literaturwissenschaftler'! sagte ich, denn
natürlich weiß ein Zuschauer an dieser Stelle normalerweise nicht,
wie der Film endet. Fünf Jahre später wird der gleiche Robert
nämlich in Anspielung einer Szene aus Melvilles "Typee" (zu
deutsch: "Taipi") in ein Kannibalendorf laufen, in diesem eine
schwarze, die Anarchie feiernde Flagge schwenken, um sich anschließend
totzustellen; woraufhin ihn ein verblüffter Eingeborenenhäuptling
mit den Worten 'Typee - mortarkee?' zur Rede stellt - in der Sprache der
dortigen Einwohner, der Typee, eine Erkundigung, ob Robert die Menschen
hier für gut oder böse hält. Und als dieser gleich Melvilles
Romanhelden 'Typee - mortarkee!' antwortet,

was so viel heißt wie: 'Typee - gut!', wird er - ebenfalls ganz wie in dem Roman, Melvilles erstem übrigens und unter seinen zehn der erfolgreichste - von den Eingeborenen aufgenommen und nicht ins wichtigste Ingrediens der Suppe verwandelt, deren Zubereitung man in den darauffolgenden Einstellungen verfolgen kann. Nun, das alles ist Belletristik, selbstverständlich versteht man als Zuschauer kein Typee - eine Sprache, die, soviel ich weiß, inzwischen ausgestorben ist und nur noch in den Brocken dieses auf autobiographisches Erleben - Melville fuhr in seiner Jugend zur See und desertierte dabei auf den Marquesas - zurückgehenden Romans existiert: soviel vom Verhältnis von Fiktion zu Wirklichkeit und wer in ihr schließlich siegen wird. Melville jedenfalls wollte nach seiner hier in Liverpool beginnenden Reise in den Orient, die für ihn eine in die Ernüchterung wurde ('Das Meer, dem keine Aphrodite mehr entsprang', notierte er mit Bezug aufs Mittelmeer) nicht mehr als Schriftsteller leben: zurück in New York begnügte er sich mit einer Beschäftigung als Zollinspektor, ein schweigsamer, bärtiger Mann, der nach Feierabend Gedichte mit religiösem Themenhintergrund verfasste. Nun - all dies ist solchem Bild einer Hafenein- oder ausfahrt bei üblichem Sehen kaum zu entnehmen; und ebensowenig kann ein normaler Zuschauer vermuten - aber ich glaube, Sie sind keine normalen Zuschauer, sonst wären Sie nicht hier, deswegen traue ich mich, es heute auszusprechen -: daß an diesem Film schon der erste Titel ernstgenommen werden will, gleich im Anschluß an die erste Einstellung, welche übrigens, wie ich bei dieser Gelegenheit ebenfalls verraten darf, den Planeten Erde in der Schwärze des Alls darstellen soll, und zwar in Form der maximalen menschlichen Anmaßung, der eines
 |
 |
Rechtecks. Auf dem darauf folgenden Titel ist 'Ein Typee Film' zu lesen,
was andeutet, daß es sich beim Kommenden um einen Film vom Typ 'Typee'
handelt, einen Abenteuerfilm also, der die Welt umspannen und eigenartige
Menschen aus der Perspektive eines jungen Mannes vorstellen will, also ohne
allzu tief greifendes Verständnis. Nein, kein Zuschauer nimmt den ersten
Titel eines Films ernst, man wäre damit auch meistens schlecht beraten
- andererseits wimmelt das Leben natürlich von nicht erkannten Beziehungen,
und so könnte man es sogar ein Zeichen von Realismus nennen, wenn sie
wie in dem Film hier en masse auftauchen, ohne bemerkt zu werden. Soviel
zur Normalität: Sie werden erkennen, daß dies eins meiner Lieblingsthemen
ist, vor allem die sogenannte Normalität des Umgangs mit Bildern -
doch zunächst bewegen wir uns weiter auf dem anscheinend so sicheren
Grund der Kindheit:
Dort, hinter der Hafeneinfahrt nämlich beginnt etwas anderes: Sie
sehen, es ist auch anders geschnitten, schneller als ein 'normaler' Film,
vor allem solche mit Handlung, so schnell, daß kaum erkennbar ist,
was genau eigentlich abgebildet wird. Bei dieser schnellen Montageweise,
die zu gewissermaßen nur noch 'flackernden' Bildern führt, so
nenne ich das jedenfalls, bekommt man dennoch die Atmosphäre des Abgebildeten
mit, in einem schnellen rhythmischen Pulsieren aufeinanderfolgender Bilder,
in diesem Fall dieser industriellen Anlagen, das verwirrend wäre, wenn
nicht die es begleitende langsame Klaviermusik es stabilisierte und - wie
Sie sehen - sogar synchronisiert: denn bei jedem neuen Klavierton, erscheint
ein neues Bild - hier also beginnt etwas anderes: die Welt der Industrielandschaften,
die, wenn man so will, die Wüste vertritt, in die man als kämpfender
junger Mensch paradoxerweise hinausstrebt aus der Behütetheit. Hier
geht es zwar absonderlich zu - das von Ihnen momentan wahrgenommene 'Geflacker'
ist wohl Teil davon - dafür bieten uns aber gerade solch öde Orte
die Möglichkeit, uns selbst zu finden, häufig zum ersten Mal,
und zwar gerade weil einen mütterliche Wärme hier nicht jederzeit
wieder umfangen kann.
 |
 |
Das Blau des Himmels verbindet dieses Flackern, das man - mir fällt
jetzt nichts besseres ein - vielleicht am ehesten als 'gottlos' bezeichnen
könnte, mit der nächsten Sequenz, welche mit einem Roberts Gang
folgendem Kameraschwenk auf die Erde hinab beginnt. Weil kontinuierliche
Schwenks vom Himmel herab etwas kitschig sind (und mit dem Weg natürlich
auch der anständige Schwenk stirbt), wird, um so das Kitschige zu reduzieren,
mitten in ihm auf eine Variante des gleichen Schwenks geschnitten, in einem,
wenn man ihn wahrnimmt, leicht irritierenden Jumpcut - das bereitet den
Text vor, der nun erklingt und dem Filmabschnitt hier als Überschrift
dient: 'Der Weg stirbt, sagte jemand'. Dieser Satz hängt, da es schließlich
vom Himmel herabkam, schwer über dem Bild, da aber bislang weder Person
noch Autorität jenes 'Jemand' recht eingeschätzt werden können,
mag es sich genauso gut um blanken Unsinn handeln - Robert, unser Held,
scheint sich jedenfalls davon nicht einschüchtern zu lassen: Wie Sie
sehen, überspringt er jetzt sogar einen Graben.

Dann könnte doch etwas bei ihm angelangt sein, eine kaum vernehmbare
Botschaft, denn nun bleibt er stehen, am Wrack eines Segelbootes, einem
Symbol beinahe von gestorbenem Weg - es ist jedenfalls kaum Überrest
von Jasons 'Argo' oder des Kolumbus 'Santa Maria', von Schiffen also, die
große Wege gingen, von denen aus Städte gegründet und Imperien
errichtet wurden - solche Art Weg ist wohl tatsächlich und endgültig
gestorben; nicht nur in diesem Film: da steht hinter unserem 'Jemand' auf
einmal die unbezweifelbare Autorität der Geschichte. Und so sehen wir
ihn in ihrem Schatten und auf gestorbenem Schiff: Robert - in der Blüte
seiner Jungenhaftigkeit; Robert, der Was-in-der-Welt!, wie der Kommentar
gleich verraten wird. Die Autorität der Geschichte scheint sogar die
Kamera zu beeindrucken, denn,

wie Sie sehen, macht sie ganz unvermittelt einen sogenannten Achssprung, und zwar auf die andere Wrackseite, was sich bei normal-dynamischem Geschichte-Erzählen ja verbieten würde - wie um anzudeuten, daß sie mit solch einem Helden, der eigentlich gar nicht da sein dürfte, und einem derart albernen Weg nichts mehr zu tun haben möchte. Aber auch von diesem leicht verbotenen Standpunkt aus bleibt Robert sichtbar, und nun vernehmen wir, daß er sich nicht nur weiterhin auf einem Weg befindet, sondern auf einem solchen zudem dabei ist, sich das Wort 'Ich' zu erobern - und das, obwohl alle Wege, und mit ihnen der Weg auch dahin, längst gestorben sein müßten. Doch weil Robert nun einmal Teil des Films geworden ist und ein Film einen Helden - er mag noch so lächerlich sein - braucht, muß die Kamera - zähneknirschend und widerwillig, wenn so eine Kamera Menschliches an sich hätte - auf die richtige Seite der Bewegungsachse zurückhüpfen - sehen sie: in diesem Moment! - und Robert auf seinem nun wenigstens film-möglichen Weg gehorsam begleiten. Im nachfolgenden Schwenk zerreißt die Welt: zwischen der bislang von uns gesehenen vulkanisch wüsten Steinlandschaft und einem erstaunt am linken Bildrand erscheinenden tropischen Blätterbüschel, mit ihm beginnt die im Film bald so genannte 'grüne Welt', in die Robert auf der Suche nach Gnade eintauchen wird. Ja, Robert ist nun tatsächlich dabei, sich das Wort 'Ich' zu erobern, am Ende des Films wird er es geschafft haben - und da ein Held jemand ist,
 |
 |
der das Wort 'Ich' ohne erröten zu müssen aussprechen darf, ist Robert, weil das Sich-Sehnen nach Gnade in unseren Augen noch immer nichts Beschämendes hat, schon jetzt zu zumindest einem brauchbaren Filmhelden geworden, dem nun jede Kamera folgen muß, wenn sie sich ernst nehmen will. Zunächst aber gilt es, die Dimensionen des Begehbaren abzustecken: die Kamera folgt also unserem Zum-Held-Werdenden und wendet ihre Aufmerksamkeit dann in einer sachten Umkehrung des Eingangschwenks, im Gegensatz dazu nun im abstrakteren Schwarzweiß, wieder dem Himmel zu, wo sie überlang verharrt: dort oben befindet sich die obere Grenze der offenen Welt, die wir bewohnen. Indes macht sich Robert schon an der unteren Grenze zu schaffen, wo er, an einer Felswand hockend, von der Feuchtigkeit der Erde zu schmecken versucht: zwischen Himmel und Erde also - das weiß natürlich jeder, aber ich möchte, indem ich es ausspreche, darauf aufmerksam machen, daß auch Gemeinplätze durch Bilder ausgedrückt werden können - muß die Eroberung des Wortes 'Ich' bewerkstelligt werden, irgendwie. Der Geschmack von Erde scheint allerdings nicht gerade Begeisterung in ihm auszulösen, ebensowenig wie Leben in Form kleiner Käfer - sein erster Versuch, in der Welt aus sich heraus erträglichen Platz zu finden, aus eigenem Recht, ist 'kläglich', wie man so nett sagt, 'gescheitert'.
 |
 |
Und so taucht das Wort 'Ich' in der nächsten Einstellung in Form eines Negativs auf: als Robert im Negativ - ein uns neuer, absurderweise kräftiger aussehender Robert, der nicht mehr Objekt, sondern Subjekt zu sein scheint und wohl auch sein will: denn nun setzt er sich seinem neuen Kraftgefühl entsprechend in Bewegung, anfangs in wieder einem Schwenk, doch dann entschlossen - aber eben nur im Negativ - in bewegungsparalleler Kamerafahrt, der Figur, mit welcher man, wie jeder Filmstudent weiß, im Film Bewegung zu maximaler Kraft verhelfen kann. Doch ach, auch sie ist nur scheinbrillant, im Negativ - die
 |
 |
Wirklichkeit brilliiert dagegen in Form wildwuchernder Vegatation, der gleichgültig bleibt, welche Form von Schimäre an ihr vorüberschreitet, leuchtend im Hintergund. Und wie vorhin in den Schwenk wird jetzt in die Fahrt geschnitten, abermals in Form eines leicht irritierenden Jumpcuts - gleich danach bleibt Robert, als hätte ihn mehr das Begreifen als die Ausführung seiner Anstrengung entsetzlich erschöpft, auch schon wieder stehen; und am Ende dieses - ach so kurzen - Scheinweges schlägt das Bild in einem weiteren, diesmal das Ende konventionellen Erzählens vorbereitenden, Achssprung wieder ins Positiv um; und da sehen wir ihn: den Mann vor dem Meer, der überlegt, ob er ins Innere, ins Höhere soll,
 |
 |
dieser Insel oder sich selbst. In der folgenden aufs neue negativ erscheinenden
Totale, die von weit weg aufgenommen ist und von der Seite, wie aus der
Sicht eines unbestechlich neutralen Betrachters, erraten wir, daß
er sich jetzt in einer Art Trancezustand befindet, einem Moment ohne eigene
Zeit, in dem Außen und Innen, Positiv, Negativ, Überlegung, Vorstellung
und Erinnerung nicht mehr zu unterscheiden sind; und richtig, auch von vorn
und näher dran erscheint unser Held jetzt im Negativ, wie endgültig
weglos - ein bloßer Betrachter. Und

dann kommt in einem zehnminütigen Flackerstück - dessen schiere
Länge an dieser Stelle im Film, nach also mehr als einer Stunde, von
tiefem Wunsch nach dem Ende gewöhnlichen Erzählens spricht und
dem noch seltsameren Bedürfnis, dies zu feiern - die Welt zum Vorschein,
in die er sich aus freiem Willen hineinbewegt: die Ödnis, die sich
in der Steinlandschaft schon angedeutet hatte. Es handelt sich um die gleiche
Wüste, die er verspielt

als Jugendlicher hatte begehen wollen - jetzt jedoch ist sie nicht mehr
Teil des Spiels, das endlich von zu Hause fortführen soll - sie ist
Teil der wirklichen Wirklichkeit. Die Wüste wächst, muntert Nietzsche
uns in ihr auf: Weh dem der Wüste in sich hat!
Soweit also diese kurze Sequenz und was ich mir in etwa dabei gedacht habe. Man wird zu Recht einwenden, daß diese Art der Beschreibung zwar möglich, vom Zuschauer aber nicht nachvollziehbar ist. Bei Film handelt es sich schließlich nicht um ein Spiel vom Typ "Ich sehe was, was du nicht siehst." Diese Art der Beschreibung wäre zwar in den Bildern enthalten, wenn ich auf ihr beharrte, würde ich aber einen ungeschriebenen Vertrag mit dem Zuschauer aufkündigen, denn ein Zuschauer sieht nun einmal das, was er sieht, und nicht das, was der Filmmacher denkt. Was aber sieht der Zuschauer in dieser Sequenz? Ich denke, vor allem einen Weg, den er nicht mit mir gehen möchte - vielleicht, weil er es nicht kann, aber ich glaube eher, weil er ihn nicht für begehenswert hält. So gesehen habe auch ich in diesem Film einen Weg konstruiert, der kaum begangen schon gestorben ist. Ich habe das einsehen müssen - das war bitter. Als nächstes möchte ich etwas vom Ort dieser Einsicht erzählen, dem Ort des gestorbenen Weges.
Ich sage erzählen, denn ich glaube nicht, daß man sich der
Frage nach dem, was man als Zuschauer sieht, wissenschaftlich nähern
kann, deshalb möchte ich es über eine Verwandlung von Erfahrung
in Belletristik versuchen. Im Leben gibt es ja nicht nur das Reich der Notwendigkeit,
dem wir ohne Zutun folgen, sondern es gibt auch das Reich der Freiheit,
in dem wir entscheiden können. Die meisten dieser Entscheidungen sind
vielleicht lächerlich, aber immerhin sind es unsere eigenen. Viele
unserer Freiheiten nutzen wir erstaunlicherweise dazu, unser Leben in Ketten
belletristischer Ereignisse zu verwandeln - eine Verwandlung der Wirklichkeit
in eine Fädigkeit, die unser Schicksal auf eine Weise umspinnt, die
uns deutlich erhabener vorkommt als das Spiel dieser geheimnisvollen Moleküle,
aus denen wir bestehen sollen und die nur unsinnigen Wahrscheinlichkeitsprozessen
unterworfen sind. Die wenigsten von uns können der Verwandlung einer
Lebensmöglichkeit in eine belletristische Figur widerstehen - im Gegenteil,
wenn das Leben uns Wahlmöglichkeiten läßt, suchen wir uns
doch immer Wege aus, die einem belletristischen Ideal entsprechen - das
gilt für die Liebe und sogar im Beruf. Was ich erzählen werde,
wird also kein Bild der Wirklichkeit sein, sondern es ist durch Freiheit
verwandelte Wirklichkeit, und wenn ich im folgenden "Ich" sage,
bitte ich Sie, dieses Ich nicht so einfach mit mir zu identifizieren. Nehmen
sie es als belletristisches "Ich", das zufällig aus meinem
Mund zu ihnen hinüberspringt und keinerlei objektive Wirklichkeit enthält.
Wirklich in diesem Zusammenhang bin allein ich als der mit eingeschränkter
Wahrhaftigkeit Sprechende.
Also - vor zwei Jahren, im Herbst 1990, war ich mit diesem Film in Rimini
auf einem Festival. Als Versuch, Aufmerksamkeit für ihn zu erregen,
endete dieser Ausflug kläglich. Dennoch aber fand ich mich irgendwann
in einer Kirche, die Tempel des Malatesta genannt wurde.

Das Gebäude ist von Alberti erbaut. Jetzt weiß ich, daß
es als eine der ersten Rennaissancebauten gilt, ich weiß auch warum.
Alberti hatte sich von dem auch in Rimini stehenden Triumphbogern des Augustus
inspirieren lassen.

Rennaissance war damals identisch mit einem irgendwie zurück nach
Rom.

In diesem Tempel sollte es in einer Nische ein Wandbild von Piero de la Francesca geben. Als ich hineinwollte, kam Joao Mario heraus. "Ein sehr gutes Fresco!" begrüßte er mich. Einen Tag vorher hatte ich ihn ebenso zufällig in Urbino getroffen. Auch er war Filmmacher und hatte einen Film im Wettbewerb des Festivals (übrigens waren wie beide die einzigen Europäer unter den Filmmachern, alle anderen kamen aus der dritten Welt oder aus Hongkong). Wir sahen uns im Hotel immer beim Frühstück, er saß meistens allein und schien gleichfalls das Bedürfnis zu haben, aus seinem Ausflug nach Rimini mehr zu machen als eine Geschäftsreise. Ich mochte Urbino nicht. Es lag auf einem Berg und es gab keinen Fluß, der die Stadt durchschnitt. Die Stadt war mir zu trocken.
An der Bushaltestelle von Urbino regnete es, immerhin. Joao Mario fragte, ob ich die Bibliothek mit den Intarsien von Pontelli gesehen hätte. Nein, das hatte ich nicht - auch Holzschnitzereien waren mir wohl im Grunde zu trocken. Aber mich hätte eine Serie von Bildern Paolo Ucellos interessiert und ein Bild von Piero de la Francesca. "Ja, die sind sehr berühmt", murmelte er nachdenklich und: "Diese Stadt ist wunderschön", dann fuhren wir beide mit dem Bus zurück nach Rimini , jeder freilich auf eigener Route.
Das Fresko befand sich in einer Nische des Seitenschiffs und war gar nicht so leicht zu finden. Auf ihm war unter anderem ein Mann zu sehen, der vor einem anderen kniete, nicht unbedingt mein Lieblingsmotiv.
Direkt davor konnte man an einem Stand Postkarten kaufen - ich kaufte
eine von dem Fresko. Plötzlich stand Joao Mario neben mir. Sehr gut,
sagte er, während er das Bild noch einmal ansah. Unversehens fühlte
ich mich haltlos. Ich interessiere mich wirklich nicht für vor einander
kniende Männer. Dennoch war an dem Bild natürlich was dran. Aber
ich kam nicht heran, in gewissem Sinne könnte man sogar sagen, daß
ich das Bild überhaupt nicht sah. Mit Nicht-Sehen meine ich nicht seine
Materialität: ich sah die Männer, blaue Farbe, rote Kleckse, das
Bild einer Festung, aber es fügte sich nicht zu etwas ganzem, es machte
nicht "Klack", oder wie man das ausdrücken soll. Es war nur
Sehen, wie es mit unserer täglichen Bewegungskoordination zusammenhängt,
das Sehen, das dazu dient, sich in der Welt zu orientieren und nicht mit
anderen Menschen zusammenzustoßen. Aber so kann man Kunstwerke nicht
ansehen, da will man etwas vom Denken wahrnehmen - das Sehen, das man dazu
braucht, war mir plötzlich abhanden gekommen. Und immer noch stand
dieser Joao Mario neben mir und musterte mich, als wollte er irgendwas von
mir hören. Ich nahm die

Postkarte hoch und verglich sie mit dem Wandbild, was mir eine gewisse Sicherheit gab - so etwas darf man schon einmal vor einem Kunstwerk tun. Ich wollte schon auf die miese Reproduktionsqualität der Postkarte eingehen, begriff aber rechtzeitig, daß ich dem Bild dadurch nicht eine Spur näher kommen würde. Ich hätte mich zwar einem Denken genähert, aber die Schäbigkeit von Reproduktionen zu bejammern ist ja selbst ein bißchen schäbig. Ich kam mir vor dem Zeugen meiner Hilflosigkeit immer hilfloser vor. Erst jetzt merkte ich, daß ich nur noch die Postkarte in meiner Hand ansah. Sie hatte für mich größere Materialität angenommen als das Original in der Wand - obwohl oder weil sie an Strukturen viel ärmer war, meinte ich der emotionalen Substanz des Bildes näher zu sein, wenn ich es auf der Postkarte anblickte. Das verwirrte mich noch mehr. So klar hätte ich das damals im übrigen nicht formulieren können, ich war nur verwirrt und wußte, daß irgendwas mit meinem Starren auf diese Postkarte nicht richtig war. Und ich schämte mich, daß mir das vor einem Zeugen passierte, einem, der von diesem Bild offensichtlich viel mehr verstand als ich selbst. Intarsien von Pontelli - davon hatte ich noch nie gehört. Was genau waren überhaupt Intarsien? Ich erinnere mich, daß ich ein paar mal zwischen Fresco und Postkarte hin- und herblickte und mich auf einmal das Gefühl überkam, zwischen den beiden Bildern gefangen zu sein- hin und her, hin und her - und nie mehr aus dieser Situation herauskommen zu können, gefangen zwischen Bild und Reproduktion gewissermaßen und bewacht von einem Wärter, der jede meiner Reaktionen bis ins Letzte begreifen würde. Furchtbar: ich haßte die hilflosen Hände, die diese Postkarte hielten - warum hatte ich sie nur gekauft? Wie war ich in diese Falle geraten? Am meisten haßte ich meine Unfähigkeit, etwas beim Betrachten des Bildes zu empfinden. Konnte sein, daß ich mich so an die Handlichkeit von Reproduktionen gewöhnt hatte, daß ich der Materialität eines Freskos nicht gewachsen war, daß ich ihr sogar ablehnend gegenüberstand? Ich sah jedenfalls nur bemalte Wand, aus der so etwas wie ein Bild gar nicht herauszutreten vermochte. An vielen Stellen war die Farbe abgeblättert und hatte nicht mehr viel von der ursprünglichen Absicht Pieros übriggelassen, aber in diesem Moment wäre mir wohl vor jedem anderen Bild das gleiche passiert - nur vor einem Monet vielleicht nicht, da bin ich ein fanatischer Empfinder. Es war ein, ich meine es mit allem Recht sagen zu können: furchtbarer Moment. Vor einer von Farbpigment irgendwie geheiligten Wand mit einem Jungen neben mir, in den ich halb verliebt war. Als er schließlich sagte: "Die Hunde sind gut, nicht wahr?" war es so erleichternd, daß ich nickte, ohne - wie ich heute denke, aber das ist, wenn ich mir die Postkarte des Bildes ansehe, natürlich unmöglich - die Hunde überhaupt gesehen zu haben. Im Übrigen ist das Dia, das Sie gerade sehen, eine Reproduktion dieser Postkarte.
Ich wiederhole, es war ein furchtbarer Moment: die Wand, die Postkarte, die schäbige Materialität der Wand, und dabei von jemandem betrachtet zu werden, von dem man weiß, daß er sehr viel mehr weiß als man selbst. Und dann noch verliebt - vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben war ich bewußt in der Position der dummen Geliebten, kein angenehmes Gefühl. "So also sieht eine dumme Geliebte ein Kunstwerk", dachte ich, "was für eine hilflose Innigkeit, die nicht das Geringste sieht!"
"Hinten ist noch eine Kreuzigung von Giotto", hörte ich
Joao Mario da sagen, worauf ich antwortete: "Mein Reiseführer
behauptet, er wäre Giotto nur zugeschrieben." "Nein, er ist
echt, ich bin ganz sicher". In einer anderen Nische des Seitenschiffs
entdeckte ich das Bild. Es hatte Kreuzform mit Ausbuchtungen dort, wo der
Körper über das Kreuz hinaustrat. Ich erinnerte mich an meine
Theorien zur Entstehung des Rechtecks, und weil Giotto so um 1300 lebte,
fühlte ich mich einigermaßen bestätigt. Zu dem Zeitpunkt,
hatte ich einmal behauptet, war das Rechteck als Bildform noch nicht etabliert.
Auch Kreuzigungen waren nicht gerade mein Hobby. War es ein Giotto? Irgendwie
hatte das Bild einen innigen Klang. Joao Mario trat neben mich. "Es
ist ein Giotto", sagte er und ich sagte: "Ja das ist ein Giotto".

Da war er also, der gekreuzigte Christus. Ich hatte natürlich schon manch ein Kruzifix gesehen, auch Bilder von Kreuzigungen, hatte mich aber nie recht dafür interessiert, am wenigsten für die darauf abgebildeten Gesichter. Es schien mir immer absurd, daß Christus auf Bildern überhaupt eine Physiognomie hat - als man die Bilder malte, wußte sicher kein Mensch mehr, wie er ausgesehen hatte. Vom Standpunkt eines Photographen waren diese Bilder halbirre Spekulation. Auch für Marienbilder galt das, auch in ihnen hatte ich nie die Gesichter studiert. Ich weiß, es klingt merkwürdig für jemanden, der sich über zwanzig Jahre mit Bildern beschäftigt hat, aber es war nun einmal so. Was hatte ich überhaupt in Bildern gesehen?
Heute weiß ich, daß es ein Giotto ist, und das nicht nur
weil ich es inzwischen auch gelesen hatte, sondern ich bilde mir ein, es
erkennen zu können. Aber dazu mußte ich mir das Bild in Büchern
genauer ansehen, und vor allem: ich mußte den Ausdruck auf dem Gesicht
von Christus studieren, und das fiel mir nicht leicht.

Drei Monate später traf ich Virginia in den Dahlemer Museen. Sie bereiste die Welt, um den Gesichtsausdruck von Engeln auf Gemälden zu photographieren. Als ich ihr erzählte, daß ich mich ähnlich systematisch mit Verkündigungen beschäftigte, wollte sie wissen wie ich darauf kam. Ich erzählte ihr von Joao Mario und beschrieb ihr seinen Film in etwa so:
Der Film spielt in Portugal, so gegen 1600, kurz nachdem es nach der
Vereinigung mit Spanien wieder unabhängig geworden ist. Die Hauptfigur
heißt Heinrich, er ist König von Portugal und wird mit einer
Prinzessin von Frankreich verheiratet. Die Ehe bleibt kinderlos. Der französische
Botschafter, der eine Politik gegen Spanien verfolgt, die Kinder aus dieser
Ehe verlangt, ist deswegen beunruhigt und erfährt, daß der König
überhaupt nicht mit ihr schläft, obwohl er ein berüchtigter
Weiberheld ist. Weil die neu errungene Unabhängigkeit Nachkommen verlangt,
sind auch portugiesische Kreise irritiert, ohne Erben würde Portugal
wieder an Spanien fallen. Zur Rede gestellt sagt Heinrich, daß er
mit der Prinzessin einfach nicht schlafen könne.

So kommt es zu einem Prozeß, in dem untersucht wird, ob das stimmt. Sollte stimmen, was der König von sich behauptet, daß er nämlich mit der Prinzessin, seiner Frau, nicht schlafen kann, müßte man ihn für regierungsunfähig erklären, weil nur, wer mit einer Prinzessin schlafen kann, König sein darf.
Der Prozeß bildet den Hauptteil des Films. In ihm berichten zunächst
eine Reihe von Frauen, wie sie vom König verführt worden sind.
Dann berichteten einige Jungfrauen mit ärztlichen Jungfräulichkeitszertifikaten,
von denen sich später herausstellt, daß sie zum Teil gefälscht
waren, wie der König außerstande war, mit ihnen zu schlafen,
obwohl sie selbst es wollten und er nicht einmal wissen konnte, daß
sie noch Jungfrauen waren. Dies überzeugte das Gericht, und beschloß
daraufhin, daß ein Mann, der keine Jungfrauen schänden konnte,
nicht König sein durfte. Es war allerdings nicht leicht, das zu formulieren,
denn ein König galt immerhin als von Gott eingesetzt, und sein Verhalten
war eher fromm. Auch zum Wahnsinnigen konnte man ihn nicht so einfach erklären,
deshalb wurde ein schwieriger, mir unverständlicher juristischer Kompromiß
gefunden, der die Nachfolge seinem Verwandten zusprach, der als vorläufig
neuer König eingesetzt wurde, während der alte König irgendwie
ein König zweiter Klasse blieb und in dieser Funktion weiterhin Frauen
wiederverführen durfte. Gleichzeitig bestätigte das Gericht der
französichen Prinzessin ohne ärztliche Untersuchung die Jungfräulichkeit,
denn die Zeugenaussagen der unberührten Jungfrauen hätten die
Disposition des Königs eindeutig beschrieben, und so konnte sie kurz
danach als Immer-noch-Jungfrau an den König von England weiterverheiratet
werden. Es ist ein sehr komischer Film, bei dem die unbefleckte Empfängnis
sich in die Unfähigkeit verwandelte, jemanden zwecks Empfangens zu
beflecken. Das war der Moment, sagte ich Virginia, an dem ich mich für
Verkündigungen zu interessieren begann. Ich glaube, auch daran kann
man erkennen, wie es die Menschen schaffen, ihr Leben in Belletristik zu
verwandeln.
Virginia fragte mich auch, ob ich den Donatello im ersten Stock des Museums
gesehen hätte und zeigte mir eine Postkarte von einem Marmorhalbrelief
von einer Mutter mit Kind.

Um die Marmorgruppe war ein dunkler Holzrahmen, der dem Ganzen wunderbar
Halt gab. Die Postkarte war - ich sage das mal so schäbig - wunderschön.
Als ich Virginia erzählte, wie sich, ausgehend von Joao Marios Film,
mein Interesse an Verkündigungen auf deren Geometrie konzentrierte,
entgegnete sie, daß sie selbst sich bei Marienbildern vor allem für
den Ausdruck auf Marias Gesicht interessierte. Marias Blick würde sie
immer wieder erschüttern, dieser Blick, der schon wußte, was
auf sie zukommen würde, aber sie hatte ja keine Wahl. Virginia kam
aus Santa Barbara und war Mutter von 4 Kindern. Auf der Suche nach ihren
Engeln hatte sie gerade Prag und Dresden bereist, später bekam ich
von ihr die Postkarte einer Verkündigung von Fra Paolo Lippi, die wir
dort oben sehen, auf der sie ihre weitere Route beschrieb: Bamberg, Rothenburg,
Würzburg, Seattle. Als ich kurz danach den Donatello im Original (und
ohne Zeugen) sah, berührte mich
- ich weiß, auch das klingt schäbig, aber vielleicht ist es
unmöglich so etwas überhaupt auszudrücken, manchmal kommt
es mir vor, als wäre eine originellere Beschreibung der inneren Zustände
beim Betrachten eines Bildes noch schäbiger - berührte mich also
der Ausdruck auf Marias Gesicht und wie sie das Kind hielt. Vor allem aber
traf mich - es ist wirklich nicht leicht, das zu beschreiben - die merkwürdige
Trennungslinie, die durch die Struktur des Halbreliefs zwischen den Gesichtern
von Mutter und Kind entstand. In ihr entdeckte ich einen seltsamen Schmerz.
Später vermutete ich, daß die Überlänge der vorhin
gezeigten Trennungssequenz des Offenen Universums genau von der Erinnerung
an den in dieser Linie verkörperten Schmerz herrührte. Ginnies
Interesse für den Ausdruck Marias war jedenfalls überzeugend.
Auf einmal kam mir seltsam vor, daß ich bis dahin in den Verkündigungen
immer nur Gabriel angeguckt hatte. Auch wenn das ein Fortschritt zu meiner
vorherigen Bildwahrnehmung darstellte, bei dem ich mich weigerte, Gesichtsausdrücke
überhaupt tiefer zur Kenntnis zu nehmen, mußte ich mich fragen,
was für eine Art innerer Zensur da eigentlich am Werk gewesen war.
Joao Marios Film war mit einer nach meinen Maßstäben unglaublichen Sorgfalt gemacht. Selten habe ich eine so kenntnisreiche Ausstattung und so innig wirkende Frauengesichter gesehen - in meiner Erinnerung hat die in Blaugrautönen arbeitende düstere Photographie höchste Eleganz. Der Film hat einen langsamen, tragenden Rhythmus, der dem grotesken Prozeßgeschehen auf eine groteske Weise angemessen ist. Die Dialoge wurden auf portugiesisch und französisch geführt, die portugiesichen Stellen waren französisch untertitelt, gleichzeitig konnte man über Kopfhörer eine italienische Simultanübersetzung des Französischen hören. Auf dem Balkon des Kinos saß die Jury des Festivals. Sie bestand aus Filmstudenten, deren Kurzfilme vor den eigentlichen Wettbewerbsfilmen liefen. Dies hatte sich jemand ausgedacht, dem die Inkompetenz und Verfilzung üblicher Juroren zuviel geworden war. Nun wollte man das Urteil dem unverstellten Blick der Jugend überlassen, dagegen ließ sich schwer etwas sagen, denn - wie wir alle wissen - der Jugend gehört ja die Zukunft.
Die Filme dieser Filmstudenten aus Moskau, Sofia, Bologna, Rom, Berlin,
London, Paris, Havanna und Los Angeles waren allerdings so grauenhaft, daß
man sich fürchten mußte. Weil Englisch die Verkehrssprache dieser
Jury war, saß sie während der Vorführung auf dem Balkon
und hörte sich die englische Übersetzung der Dialoge des Films
an. Die Übersetzerin hatte eine quäkige Stimme und wußte,
wie wichtig ihre Aufgabe war, deshalb übersetzte sie so laut, daß
man sie überall im Kino hören konnte. Ihre Übersetzung ins
Englische basierte auf der italienischen Simultanübersetzung der französischen
Dialoge und Untertitel. Selbst mein kümmerliches Französisch konnte
erkennen, daß am Ende dieser Kette um etwa zwanzig Sekunden verspäteter
Blödsinn herauskam. Trotz dieser Verstümmelung hatten die Dialoge
immer noch eine geistreiche Quirligkeit, die der verdrehten Schlüpfrigkeit
des Sujets entsprach und sich in dem langsamen Bildrhythmus wunderbar verdrehte.
Die quäkende Übersetzung war fürchterlich, nach einiger Zeit
setzte ich mich im Kino ganz nach vorne - sonst nicht unbedingt mein Lieblingsplatz
- und hielt mir die Ohren zu, um wenigstens diese Übersetzerstimme
nicht hören zu müssen. Ich fand Joao Marios Film erstaunlich.

Einer der Juroren war ein rotbärtiger No-Nonsense Sozialarbeiter
aus London. Als ich ihm sagte, ich hätte die Übersetzung als furchtbar
empfunden, sagte er, Ja das stimmte, aber das wäre nur schlimm gewesen,
wenn es sich um einen guten Film gehandelt hätte. Und Straub erzählte
mir, ein russischer Juror hätte den Film zwar ganz interessant gefunden,
aber trotzdem als schlecht, weil er nicht schnell genug geschnitten war.
So bekamen wir jedenfalls einen Einblick in die kinematographische Zukunft.
Nietzsches Satz von der wachsenden Wüste bekam hier auf einmal überraschend
Bedeutung. Joao Marios Film, meiner und einer aus Niger waren die einzigen
im Wettbewerb, die keinen Preis bekamen. Fairerweise muß man zugeben,
daß im Jahre 1991 jede andere realistisch vorstellbare Jury ähnlich
entschieden hätte. Die Jugend der Welt reagierte nicht anders als jeder
andere wichtigtuerische Idiot.
Nach dem Film wollte ich etwas am Strand laufen. Ich hatte die letzten
Tage Herzschmerzen und wußte nicht, ob ich mich nur im Schlaf verlegen
hatte oder ob es sich um eine wirkliche Krankheit handelte. Vielleicht war
es ja auch nur das bekannte einschnürendes Gefühl der eigenen
Minderwertigkeit, das einem häufig auf Festivals begegnet. Am Strand
begann gerade der Abend. Ich war in meinen Gedanken noch bei dieser Filmvorführung,
da war er ganz plötzlich da, dieser Strand, ja, so muß ich es
wohl ausdrücken, ganz plötzlich, nicht als Terrain, als etwas
ganz anderes als Terrain, er war eine Art Offenheit, eine weite Offenheit,
die in den Kopf eintrat - eine enorme Erleichterung nach all dem abgedunkelten
Kinoerleben der letzten Tage. Ja, hier war offene Welt, in die man laufen
konnte, Wasser und Abend und Strand, und ich lief barfuß hinein in
die Weite und spürte dabei wieder die Schmerzen in der Herzgegend,
und auf einmal wollte ich sterben, dieser Gedanke kam wie ein kurzer, heftiger
Schnitt. Ja, sterben, ganz klar spürte ich es auf einmal, jetzt und
in dieser Weite wollte ich sterben, während des Laufens, in kurzem
heftigen Krampf. Und so lief ich den Strand entlang und "Sterben"
wiederholte es sich in mir, "ich will sterben", und während
ich weiterlief und nicht starb, fragte ich mich, ob ich tatsächlich
sterben wollte, doch da meinte ich schon zu 80 Prozent: "Nein!"
Inzwischen weiß ich, daß solche Anwandlungen bei Männern
meines Alters ganz normal sind. Sie entstehen in Momenten, in denen man
merkt, wie der Geschmack der Jugendlichkeit, der Festivals wie dem von Rimini
angeboten werden muß, sich in einem verflüchtigt hat, das Versprechen
des Wachsenwollens und des Gleichmuts, der sich bei einer Niederlage schon
einen neuen Weg suchen wird, und wo man zu spüren glaubt, daß
die Wüste, in die hinein man sich so spielerisch bewegt hat, wirklich
ist - wirklich, gnadenlos und unendlich. In diesen Momenten wird das Kreuz
plötzlich als Pluszeichen interpretiert: man ist nicht mehr lebendig
und noch nicht tot, man ist nur noch zähe Substanz. Womöglich
ist genau dies auch der Moment, in dem wir unsere Augen noch einmal öffnen
können und uns angemessener in der Wirklichkeit einzuordnen vermögen,
anders jedenfalls, als man das als vor Selbstbehauptungswut berstender Jugendlicher
versteht. So gesehen beginnt vielleicht erst nach solchen Momenten das sogenannte
wirkliche Leben.
Nun, wirklich oder nicht - in dieser Nacht starb Alberto Moravia. Ich
dagegen traf Joao Mario am nächsten Morgen beim Frühstück.
Bei der Fotographie seines Films hätte er negatives Licht benutzt,
sagte er, das würde folgendermaßen funktionieren: man leuchtet
die Szene zuerst ganz gleichmäßig aus, und nimmt dann immer mehr
Licht weg, bis es einem richtig erscheint. Es wäre ein subtraktives
Verfahren, und wirke anders als die amerikanische Methode, bei der auf ein
Grundlicht mehrere Glanzpunkte gesetzt werden. Das sei jedenfalls seiner
Ansicht nach eines der Geheimnisse seiner Fotografie. Als ich das Daniéle
später erzählte, sagte sie: "Ach er meint Neger!" -
Neger sind Klappen, die sich an den Scheinwerfern befinden, um ihr Licht
zu maskieren. Bei der Bildkomposition habe er sich an die Schule von Fontainebleau
gehalten. "Die beiden Frauen, die sich an die Brustwarzen fassen?"
fragte ich, "Ja", sagte er, und es sei sehr schwer gewesen, den
Ausdruck auf den Gesichtern so hinzubekommen wie auf diesen Bildern, die
Schauspielerinnen wollten sich einfach zu sehr bewegen.
Inzwischen hatte ich begriffen, daß er ein katholischer Filmmacher
war, und daß Marienverehrung im Zentrum seines ästhetischen Empfindens
stand. Ob mir Urbino gefallen hätte, fragte er, und blätterte
in dem Piero de la Francesco Buch, in dem ich zum Frühstück eigentlich
lesen wollte. Als Bewohner eines flachen Landes könne ich für
Hügellandschaften kein rechtes Gefühl aufbringen, antwortete ich,
im Grunde hätte mir schon die Abwesenheit eines Flusses wirkliche emotionale
Beteiligung unmöglich gemacht. Ihm als Portugiesen ginge das wahrscheinlich
anders, dort wären Hügel und Berge nie weit vom Meer. Ähnliches
gälte für seine Frauenporträts - ich bewundere sie sehr,
könnte mir aber als Protestant keinen Arbeitsprozeß vorstellen,
der mich durch Kleinstarbeit zu diesem Optimum an Ausdruck brächte.
Ich könne Schönheit nicht herauspolieren, sie wäre für
mich nur zufällig erreichbar. Ich würde mehr auf die geometrischen
Aspekte des Ausdrucks achten, und besonders interessierte mich dabei der
Bildrand - vielleicht fände er das als Angehöriger einer Seefahrernation
auch interessant, und dann erzählte ich ihm von meinen Überlegungen
zum Rechteck.
"Warum sind Filmbilder rechteckig?" fragte ich ihn. Gutmütig
ging er drauf ein, er hatte verstanden, daß ich seinen Film mochte:
"Nun?" Der Idee der Linse jedenfalls würde ein rundes Bild
viel eher genügen, fuhr ich fort. Das von der Linse auf die Emulsion
geworfene Bild wäre ja rund, nur die rechteckige Form des Bildfensters
macht es zum Rechteck. Zwar würde manchmal behauptet, man nähme
in Filmen die Wirklichkeit aus der Perspektive der handelnden Personen wahr,
doch auch dies würde in Anlehnung an unsere Wahrnehmung ein eher ovales,
an den Rändern verschwimmendes Bildfeld begünstigen. So gesehen
sprächen eigentlich nur die Kosten für rechteckige Bilder - kreisförmige
gleicher Auflösungsqualität kosteten geringfügig mehr an
Material - geringfügig jedenfalls in Relation zu den tatsächlich
anfallenden Kosten der Filmproduktion. Das Rechteck des Filmbildes sei -
mir fiel kein anderes Wort ein - Ideologie.
Die Erfinder des Kinos imitierten natürlich die Erfinder der Photographie.
Schon dort gab es

eine Entscheidung für das Rechteck. Bei der Plattenphotographie
war sie noch unvernünftiger als beim Film, denn durch die Rechteckskaschierung
wurde etliches vom bei den damals erforderlichen langen Belichtungszeiten
dringend benötigten Licht verschwendet. Die Entscheidung für das
Rechteck war auch in der Photographie schon Ideologie.

Die Photographie versuchte natürlich nur, die Malerei zu imitieren
- in der hatte das Rechteck schon eine lange Tradition. Wie also kam die
Malerei zu ihrem Rechteck?
*
Eine rechteckige Leinwand läßt sich leichter spannen, als
eine irgendwie anders gestaltete, und so könnte es hier einen funktionalen
Zusammenhang geben. Doch die Wahl des Bildträgers selbst ist schon
Ideologie. Auf Stein, Holz oder einem anderen festen Material braucht man
keine Leinwand zu spannen und jede Form könnte Bildform sein. Das Rechteck
aber wurde Grundlage der Ästhetik der Malerei, und das in einer Umgebung,
die das Rechteck eher gering schätzte, die spätestens seit dem
Barock von Kraft und Dynamik und geschwungenen Linien träumte, die
den Begriff der Unendlichkeit schuf und die Idee der mathematischen Funktion,
der das Universum zu gehorchen hatte.
*
Zunächst, bis weit hinein in die Gotik, zum Teil noch über
sie hinaus, wurden Bilder und farbig strukturierte Flächen fast unterschiedslos
auf alles mögliche aufgetragen: in Höhlen, Katakomben, auf Altäre,
Skulpturen, Wände, Decken, in Zwickel, Fensterrahmen und als Glasmalerei
auch in Fenster. Manches - die auf ganz eigener Logik basierende Entwicklung
der Buchmalerei übergehen wir hier - folgte der Rechteckform, das meiste
nicht. Mit der Entdeckung der zentralperspektivischen Abbildung änderte
sich das allmählich. In Giottos Ausmalung der Capella dell Scrovegni
von etwa 1305 ist die Wand schon in Rechtecke zerlegt.

In jedem dieser Rechtecke gibt es eine eigene schüchterne Perspektive. Vielleicht aber sollte man gar nicht so nachdrücklich von mehreren nebeneinandergebrachten Bildern reden, eher schon von mehreren Phasen der großen Geschichte, die in der Kirche nun einmal erzählt wird, und in diesem Sinne handelt es sich um ein einziges großes Bild in Form des gesamten Innenraums einer Kirche. Die Idee der Perspektive und die Bildform "gesamter Innenraum einer Kirche" waren jedoch nicht so einfach miteinander vereinbar: so entstanden mehrere Bilder mit jeweils eigenen Perspektiven, die an den Wänden nebeneinander zu sehen sind. Jede von ihnen benötigte als verkleinerte Abbildung eines unendlichen Raums eine Begrenzung.
Daß die Wahl gerade auf das Rechteck fiel, läßt sich
monokausal wohl nicht begründen. In den Mosaiken von San Maria Maggiore
in Rom und S.Apollinare Nuovo in Ravenna gab es bereits 800 Jahre vor Giotto
Rechteckfolgen,

und das ist besonders interessant, weil die Mosaiken der gleichzeitig
entstandenen anderen ravennaischen Kirchen schon ganz byzantinisch den gekrümmten
Kuppelraum selbst in einer bizarren, ineinander verflochtenen Geometrie
füllen.

Im Urteil des Spätmittelalters wurde das Rechteck durch die Analogie
zur Fensterform gestützt. Von der Fensteranalogie ausgehend wurden
oft auch romanische oder gotische Begrenzungen versucht,

die aber allmählich verschwanden, vielleicht weil man vage die Möglichkeit eines cartesischen Koordinatensystems spürte, das Fluchtpunktkonstruktionen erheblich vereinfacht. Und schließlich darf man das merkwürdige Zerfasern der perspektivischen Abbildung zum seitlichen und unteren Rand hin nicht vergessen, das nach einer geraden Abgrenzung förmlich schreit. Innerhalb des flachen Rechtecks konnte man die Gesetze der Perspektive klarer fassen. Und so redet der gleiche Alberti, der den Tempel des Malatesta erbaute, am Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts (obwohl er, der so viel mit romanischen Öffnungen arbeitete, gleichzeitig am Blick durch ein wie immer gestaltetes Fenster als Grundidee der Malerei festhält) schon wie selbstverständlich von einem Bild als rechteckigem Schnitt durch eine sogenannte "Sehpyramide".
Dennoch gab es von Michelangelo, Raffael und Botticelli noch bis 1530
ehrgeizige Rundbilder, erst dann verlor sich diese Form in Maniriertheiten
- interessanterweise erst nach dem endgültigen Sieg der Vorstellung
von der Kugelgestalt der Welt. Nicht einmal die Einheit der Zeit in einem
Bild war unumstritten. Nicht nur in zahlreichen Arbeiten Botticellis werden
in einem Bild mehrere Zeitpunkte - des Lebens des heiligen Zenobius etwa
in der National Gallery in London - beschrieben. Als in Bildern nur noch
ein Zeitpunkt zugelassen war, bekam das Rechteck eine neue Funktion: es
diente als Verschluß gegen das Eindringen von anderer Zeit. Wenn wir
den spätrömischen, vorbyzantinischen Mosaiken trauen wollen, war
dies vielleicht sogar sein Ursprung. Das Bildinnere jedenfalls bestand erst
von etwa 1500 an gesetzmäßig aus einem zusammenhängenden
Ort an einem festen Zeitpunkt.

*
Grundidee der perspektivischen Abbildung ist es, ein Kleines für
ein Großes zu setzen. Das Große öffnet sich in Richtung
des Fluchtpunktes bis zur Unendlichkeit, doch zur Seite hin ist es beschränkt.
Bilder lassen sich nicht beliebig breit machen, irgendwann bricht die Zentralperspektive
zusammen. Der Rand ist das eigentlich Unheimliche an der perspektivischen
Abbildung, es ist der Bereich, in dem sie versagt. Es ist wie bei unserem
Blickfeld, auch in dessen Randbereich verwehrt eine eigenartig verschwommene
Geometrie dem analytischen Denken jeden Zugang. Die entschlossene und klare
Begrenzung der Malerei durch das Rechteck ist eine Reaktion auf diese Unverständlichkeit.
Wir begreifen, was innerhalb des Rechtecks liegt, bis hin zur Unendlichkeit,
bis dorthin, wo sich die Parallelen schneiden - doch an den Rändern,
da gnade uns Gott.
*
An den Rändern der Perspektive war auch der Ort für die Angst
vor dem Abgrund am Ende der Welt. Als die Perspektive erfunden wurde, war
vielen die Welt noch Scheibe und die Furcht vor einem Herabfallen von ihrem
Rand entsprechend real. Das Rechteck sperrte das räumliche Ende der
Welt aus dem Bild und verhinderte das Eindringen der Wächter des dortigen
Abgrunds, all der Meeresungeheuer und menschenverschlingenden Schlangen,
von denen die Seeleute vor Kolumbus so seltsames zu berichten wußten.
Ein massiver und solider Holzrahmen, der die Linie am Bildrand noch extra
stützte, beruhigte noch mehr, er wirkte wie eine Mauer, die Unheimliches
fernhielt und zugleich ein Herabfallen des Betrachters verhinderte. In den
Verschnörkelungen der Bilderrahmen erkennt man die Seeschlangen vom
Ende der Welt noch heute.
*

Auch in einem Kupferstich von Martin Schongauer von 1470: "Die Peinigung des Heiligen Antonius" können wir etwas davon erkennen. Um den in der Luft schwebenden heiligen Antonius bilden Dämonen und Ungeheuer eine Art Ring und zerren an ihm. Außerhalb dieses Rings sind unten Felsen angedeutet und oben durch Striche der Himmel, die beide durch die Linien des Rechtecks begrenzt werden. Sogar in dieser Karikatur von Perspektive gibt es dem Geschehen im Zentrum Raum und schottet es vom Bereich ihrer Unzulänglichkeit ab, hält also, wenn wir unserer Metapher weiter folgen, das Ende der Welt draußen. Interessant aber ist nun, daß die Ungeheuer vom Ende der Welt, die sich sonst erst in der Verzierungen der Holzrahmen finden, hier schon innerhalb des Bildes zu sehen sind: Sie bilden einen Rahmen innerhalb des Rahmens, der die gepeinigte Heiligkeit des Antonius umschließt. Es handelt sich um eine Darstellung der Angst vor dem Innenleben und die Rahmung besteht aus den Ungeheuern am Rande unseres Bewußtseins, die uns unsere Heiligkeit unmöglich machen wollen. Sie bilden eine Art perversen Heiligenschein um den Heiligen Antonius.
Von diesem Bild aus gibt es zwei logische Fortsetzungen. In der einen wird der Heiligenschein in ein Rechteck verwandelt, das den Heiligen unschließt, und es entsteht ein Bild, aus dem das Böse entfernt worden ist, und bei dem das Rechteck als eine Art Festungsmauer dient, die das Böse ausschließt. In seinem Inneren entsteht so eine Art Konzentrat des Heiligen, das wir aus den Mariendarstellungen kennen, und dessen weltliche Ambivalenz sich am auffälligsten vielleicht in den Ruhm des Lächelns der Mona Lisa verwandelte.
Wenn man sich dagegen im Bild vom gepeinigten Heiligen Antonius den Heiligen Antonius selbst aus dem Bild entfernt denkt und nur die Ungeheuer übrigließe, wird der Rahmen zu einer Art Zaun um einen Zoo des Bösen. Dies ist die andere Möglichkeit, die sich zunächst in einigen Bilder von Bosch und Breughel realisierte, deren geometrische Aspekte in diesem Sinn zu begreifen sind. Diesem Weg ist später auch die Rechtecksetzung der modernen Malerei in etwa gefolgt.
Vorher aber wurde das Individuum entdeckt und dabei verwandelte sich
das Grauen vom Rand der Welt in das Grauen im Zentrum: in den gekreuzigten
Christus und den gekreuzigten Christus in uns, der 150 Jahre nach Schongauer
in El Grecos Heiligen Hieronymus stellvertretend für das inzwischen
erstandene Individuum die Frage stellt: Was

geschieht mit mir! Wer bin ich, daß mir dies geschieht - kann ich
etwas dagegen tun? Dieses Individuum ist noch nicht besonders anspruchsvoll:
es hat gar nicht den Ehrgeiz, ein handelnder, die Welt verändernder,
optimistischer Held zu werden wie Don Quichotte oder ein philosophierender
Hampelmann vom Typos Hamlet, es reicht ihm schon, sich im Spiegel zu betrachten
und daraufhin einen vernünftigen Entschluß zu fassen wie der
heilige Hieronymus, der nach Askese und Reue die Bibel ins Lateinische übersetzte
- die Vulgata - und sich in späteren Jahren gern von den römischen
Damen betrachten ließ.

Die moderne Malerei wollte auf stellvertretende Betrachter wie den Heiligen Hieronymus verzichten. Was dabei geschah, wird in den Selbstporträts van Goghs augenfällig - er geht das Innen auf direktem Wege an. Auch seine Landschaften sind als abstrakte Selbstporträts zu verstehen, in denen die Angst vor dem Außen und Großen sich in eine Angst vor dem Innen und seiner Wahrnehmung verwandelt hat.
Die Idee des Perspektive jedenfalls war nach der Eroberung der Welt schon
banal. Als sie um 1850 durch die Photographie seriell erzeugt werden konnte,
betraf das die Malerei gar nicht mehr, eigentlich vereinfachte es nur ihre
Befreiung. Während die Photographen sich nun bemühten, die perspektivische
Malerei zu imitieren, konzentrierten sich die Maler auf die Substanz der
Wahrnehmung und des Rechteckinneren. Der Weg in die Abstraktion machte die
Malerei wieder aktuell, und es ist nicht schwer, das hier Angerissene bis
zur Ästhetik von etwa Pollock, Rothko oder Stella fortzusetzen. Die
europäische Photographie des letzten Jahrhunderts dagegen überlagerte
sich mit einer süßlichen Soße,

deren angenehmster Teil ein enzyklopädischer Realismus war, wie
er sich später in den Wochenschauen äußerte.
*
In Amerika war das etwas anders: hier hatte die Angst vor Raum noch eine
Basis. Der beschwörende Charakter des Rechtecks war vor der Weite der
Natur noch kein entleertes Ritual. Im amerikanischen Bürgerkrieg dann
kreuzten sich die Angst vor dem Außen, vor dem Raum, der durch die
Perspektive erschlossen wurde, mit der Angst vor dem Innen, vor dem also,
was auf den Rechtecken zu sehen war, dem Unfaßbaren der - wie Goya
sie nennen wollte - Greuel des Krieges. So entstand im Bürgerkrieg
eine amerikanische Kultur, deren doppeltes Symbol das Rechteck wurde. So
gesehen erstaunt es nicht weiter, daß fünfzig Jahre später
mit Griffiths Sentimentalisierung dieses Bürgerkriegs in The Birth
of A Nation die Filmkunst entstand und jene Kathedralen zur Anbetung des
Rechtecks, die wir gewöhnlich als Kinos bezeichnen.
Nun, das ist jetzt alles ganz nett und folgerichtig formuliert, damals am
Frühstückstisch aber muß es ein ziemlich zusammenhangsloses
Gestammel gewesen sein. Immerhin leuchtete Joao Mario als Angehörigem
einer Seefahrernation die Ausgrenzung des Endes der Welt und die Notwendigkeit
der Begrenzung der perspektivischen Konstruktion durch das Rechteck sofort
ein. Die Verwandlung des Rechtecks in einen Container des Inneren kommentierte
er mit einem: Absolut richtig, schon Poussin, den er recht gut kenne, habe
geschrieben, Bilder seien

vor allem Landkarten des Inneren, des Bewußtseins. In diesem Sinne
wäre das Rechteck eine Art Behälter dieses Bewußtseins.
Wir sahen uns die Reproduktionen an, die ich aus Urbino mitgebracht hatte.
Auf Ucellos "Schändung der Hostie" aus dem Jahre 1450 überraschten
uns

nicht nur gedrechselte rote Säulen als Bildbegrenzung, welche die
sechs wie in Comicstrips nebeneinanderstehenden Einzelbilder voneinander
trennen, auch sein Versuch, die Landschaft der verschiedenen Einzelbilder
hinter den Säulen zu verbinden, schien bemerkenswert, in ihm entsteht
ein merkwürdiges und hochinteressantes Raumkontinuum verschiedener
Zeiten. Noch um 1450 waren Rechteckrahmung und einheitliche Zeit offenbar
noch nicht unhinterfragte Randbedingungen intelligenter Malerei. Selbst
wenn das Rechteck benutzt wurde, gab es oft eine merkwürdige Unentschlossenheit
in seiner Innenstruktur. Häufig entstanden Unterrechtecke, die durch
im gleichen Bild vorhandene getrennte Räume verursacht wurden. In dem
Piero della Francesca - Buch entdeckten wir mit der Geißelung Christi
von 1450 ein solches Doppelbild, das eigentlich aus zwei Bildern mit unklarem
Bezug aufeinander bestand.

Joao Mario blätterte weiter und sagte: "Ja, hier gibt es eine
ganze Reihe von Bildern, bei denen man das sehen kann, auch bei dieser Verkündigung
hier sind die Räume getrennt. Diese ist übrigens untypisch",
fuhr er fort,

"hier guckt Maria den Engel direkt an, sie kann das tun, weil eine
Säule direkt zwischen ihnen steht, normalerweise blickt sie im Halbprofil
nach links ins Leere. Aber auch hier gibt es diese Raumtrennung. Das erinnert
übrigens sehr an das Schuß-Gegenschuß-Verfahren im Film",
fuhr er fort: "Ich habe beim Drehen meiner Schuß-Gegenschußpaare
immer versucht, den Gesichtsausdruck von Maria genau in diesem Halbprofil
hinzukriegen." "Sehr katholisch", sagte ich, "die Beschäftigung
mit der unbefleckten Empfängnis, und das dann mit einer Begriffsbildung
wie negatives Licht zu koppeln". "Tja", meinte er dazu, aber
wenn ich mich für Geometrie interessierte, würde ich bestimmt
die Säule zwischen dem Engel und Maria interessant finden. Oft wäre
sie nur angedeutet, aber sie sei auf allen Verkündigungen vorhanden.
Woher er das alles wisse, fragte ich, und ob er denn so viele studiert hätte.
"Ja, für den Film", meinte er, und das mit der Säule
wäre ganz bekannt. "Die Säule ist doch bestimmt der Penis
Gottes", sagte ich, "den sie sich nicht anzublicken traut".
"Nein, nein", sagte er unamüsiert, "so etwas liegt dem
Denken von damals fern. Nein, der Literatur nach repräsentiert sie
den heiligen Geist". "So, so, der heilige Geist also", meinte
ich, "weißt du, daß ich selbst, wenn ich nur Landschaften
photographiere, später immer sexuelle Untertöne in der Bildkomposition
entdecke?" Oft wäre doch an gerade den einfachsten sexuellen Modellen
in Bezug auf das Schöpferische was dran. "Nun, vielleicht",
sagte er höflich, doch dann plötzlich mit erhöhter Intensität,
"Nein, es ist der heilige Geist, you must believe me, Klaus, it is
well known." Man sieht, auch so kann man sich näher kommen.

Inzwischen habe ich mir selbst hunderte von Verkündigungen angesehen,
tatsächlich ist außer bei exzentrischen Versionen wie der von
El Greco oder einem Meister Bertram in Hamburg, zu dem sich das womöglich
noch nicht herumgesprochen hat, fast immer die Andeutung einer Säule
zwischen Maria und dem Engel zu sehen, oft eigenartig maskiert, zum Beispiel
als Ständer eines Blumentopfs. Worum geht es bei der Verkündigung?
Eigentlich verkündet der Erzengel Gabriel Maria ja nur, daß sie
den Sohn Gottes gebären wird. Da aber Jesus jungfräuliche Geburt
seit dem Hochmittelater christliches Dogma ist, muß mit Sorgfalt der
Eindruck vermieden werden, er könne die Frucht einer zufälligen
Begegnung Marias mit einem Handlungsreisenden namens Gabriel sein - die
Begegnung muß also züchtig verlaufen. Die sich in einer langen
Tradition entwicklende Bildlösung bestand darin, die beiden zunächst
(bei Giotto in der Srovegnikapelle und auch in unserem Beispiel dem Maestro
del Bambino Vispo um 1420) in getrennten Bildern auftreten zulassen, die
sich durch symmetrische Hängung aufeinander bezogen. Als später
gestattet war, sie in einem Bild zu zeigen, variierte man diesen Gedanken
und ließ Maria sich in einem Innenraum aufhalten, während Gabriel
sich im Freien befindet (Lippi). Es waren also zwei Bilder in einem, deren
Trennung voneinander ideologisch begründet war. Als die beiden sich
dann in der logischen Fortsetzung dieses Gedankengangs auch in einem einzigen
Raum aufhalten durften, blieb als Echo dieser Tradition in Züchtigkeit
die zwischen ihnen stehende Säule übrig, die also keineswegs meinem
dümmlichen Vorschlag entsprechend als Schwanz Gottes interpretiert
werden darf, sondern als Instanz von Wohlanständigkeit. In diesem Sinne
hatte Joa Mario tatsächlich ins Schwarze getroffen: im Film wird im
Schuß-Gegenschuß-Verfahren durch den Schnitt eine ähnliche
Personentrennung erzeugt, um zu verhindern, daß die Beteiligten in
einem Bild zu sehen sind und in Form von Vergewaltigung, Inzest, Bruder
und Vatermord übereinander herfallen können. Tatsächlich
ist diese Trennung nach dem Verkündigungsmuster ja zur Methode geworden,
nach der filmische Spannung erzeugt wird - sie versagt erst da, wo die Trennung
endgültig aufgehoben ist, in Pornofilmen, in denen die geschlechtliche
Vereinigung tatsächlich sichtbar vollzogen wird. Dort wirkt das Schuß-Gegenschuß-Verfahren
lächerlich, absurd und obsolet. In Verbindung mit Pornographie ist
vielleicht interessant, daß die erste von mir gefundene Verkündigung
ohne dazwischenstehende Säule aus dem Gebetbuch des

Lorenzo de Medici von 1485 stammte, also für die privaten Augen eines Fürsten bestimmt war, der sich ohne Zeugen dazu denken mochte, was er wollte. Das war natürlich bloß Zufall.
Die Säule steht offenbar zumindest zum Teil für die Raumtrennung
zwischen der Verführten und dem möglichen Verführer. Bei
ihrer Identifizierung mit dem Heiligen Geist scheint sich Joao Mario trotz
seines inständigen Bittens, ihm zu glauben, geirrt zu haben - der Heilige
Geist taucht meist in Form einer Taube auf ,

das "well known" war für mich in der Fachliteratur nicht
zu entdecken. Tatsächlich wurde in der mir zugänglichen Literatur
nicht einmal die Säule erwähnt, es handelt sich womöglich
um Joao Marios Entdeckung. Nein - die Säule repräsentiert nicht
den Heiligen Geist, und auch wenn mir die Schwanz-Gottes-Interpretation
als schmutziger Nebengedanke manchmal noch immer ganz lieb ist, erscheint
als seriöseste Hypothese wohl, daß es sich bei ihr um ein Symbol
für die Kirche handelt, mit deren Hilfe man geschlechtliche Versuchung
überwindet und die Jungfräulichkeit einer Geburt garantieren kann.

Virginia hatte von dem traurigen, dem wissenden Gesichtsausdruck Marias
auf den Verkündigungen erzählt. Bei Donatello fühlen wir,
daß sie das Mutterglück für einige Zeit versöhnen wird,
dort ist der schwere dunkle Rahmen ein Symbol für die Abgeschlossenheit
der Innigkeit ihrer Liebe, in die nichts von außen eindringen wird,
nicht einmal der Haß Gottes auf seinen Sohn. Nur der merkwürdige
Strich zwischen Mutter und Kind verkündet die unvermeidlich werdende
Trennung. Ein genauerer Blick auf die geraden Linien an den Rändern
des Halbreliefs verrät etwas von der Bewußtheit, mit der Donatello
diese Rahmung vollzog. Die Linien im Marmor deuten ein Zimmer in perspektivischer
Verkürzung an, in dem sich die beiden befinden. Seine hintere Wand
bildet einen Rahmen für Jesus, während Marias Kopf durch ihn hindurchsticht
und so der Welt zugewandter ist. Die vordere Rahmung dagegen, die entsteht,
weil das Zimmer wie in einer Puppenstube aufgeschnitten ist, schützt
auch Maria vor dem Außen. Dann erst kommt der Holzrahmen, der die
Zerbrechlichkeit dieser Konstruktion noch einmal besonders stützt.
Innerhalb dieses Holzrahmens hat sich also eine komplizierte Befindlichkeit
konzentriert, die gleichzeitig ein merkwürdiger Spiegel von etwas aus
uns ist.

Das Kruzifix Giottos dagegen braucht keinen Rahmen: Jesus ist allein, er braucht nicht eingesperrt oder geschützt zu werden: Ans Kreuz genagelt kann er nicht fliehen: wer ihn berühren will, kann ihn berühren. Wenn er zusätzlich gerahmt wird, soll sein Zustand betont werden. Erst die gewollte Zusammenfassung von zwei oder mehr Personen verlangt das Rechteck. Solange die Personen wie in den Byzantinischen Mosaiken relativ wahllos nebeneinanderstanden, mußte aus der Bibel herausgelesen werden, wie sie sich aufeinander bezogen. Mit der Rahmung wurde die Wirkung von Bildern ohne Worte verstärkt. Es wurde entdeckt, daß bestimmte Personenkonstellationen emotionale Einheiten bildeten, die über einen literarischen Zusammenhang weit hinausgingen. Das gerahmte Bild enthielt plötzlich ein Gefühl. Es wurde zum Bild eines Gefühls, das nach außen hin abgedichtet werden mußte, um zu verhindern, daß zusätzliche Elemente seine fragile Substanz zerstörten. Genaugenommen war das Gefühl gar nicht auf dem Bild, dort waren nur Personen und Gesten, die man irgendwie benennen konnte, das wirkliche Gefühl - heute könnte man es vielleicht als psychoanalytische Resonanz bezeichnen - existierte in einem selbst; ja, in einem gewissen Sinne war man es selbst, weil es ohne intensive Betrachtung gar nicht existierte. Es war etwas jenseits der Benennungsmöglichkeiten der damaligen Zeit, es war etwas ohne das Wort, etwas sehr Zerbrechliches, das mehrere aufeinanderfolgende Generationen von Künstlern benötigte, um reine Gestalt zu erhalten. Um den gekreuzigten Christus gab es eines dieser Gefühlsfelder, um Maria mit dem Kind natürlich, und eines von vielen anderen ist auch die Verkündigung.
Gleichzeitig beginnt mit dem Rahmen um ein solches Gefühl etwas
anderes.

Es beginnt das Mitgefühl mit einem anderen Menschen. Mit der Rahmung wurde die Innigkeit faßbar - auch hier in diesem Bellini spürt man die Bewußtheit, mit der die verschiedenen Rahmen gesetzt wurden - und mit der Innigkeit beginnt über eine psychonalalytische Resonz das Mitgefühl, zunächst mit den Erscheinungen auf dem Bild, in denen man Aspekte von sich selbst erkennt, und dann durch Übertragung: Warum Vater, Mutter habt ihr mich in die Welt geschickt? Warum habt ihr mich verlassen. Und das setzt sich fort in das Mitgefühl mit anderen Menschen, denn gleichzeitig wissen wir sehr wohl, daß wir nicht Christus sind, in seinem Leiden ist er auch immer der andere.
Beim Betrachten von Tierfilmen wird dieser Prozeß oft verblüffend deutlich. Einmal habe ich in einem Film über Vögel geweint, es ging um eine Vogelart, die ihre Nester in Steilküsten baute. Irgendwann warfen die Eltern ihre Jungen über die Nestkante: wer nicht fliegen kann, zerschellt auf dem Boden. Jedes dritte Junge kam dabei um, furchtbare Bilder. Das Weinen darüber ist natürlich das Weinen um einen selbst, denn in diesem Zerschellen auf dem Boden erkennen wir uns alle wieder, all unsere Leben enden in einem Scheitern: die gewisse Wärme, die es einmal gab, werden wir nur als Karikatur wiederfinden, meistens nicht einmal das. "Die Zwei blauen Augen von meinem Schatz", läßt der junge Mahler singen, "die haben mich in die weite Welt geschickt", und mir war eigentlich immer klar, daß es sich dabei um die grauen Augen meiner Mutter gehandelt hat, und der Gang in die Welt ist ein entsetzlich langer Fall, an dessen Ende wir zerschellen werden - da fühlen wir uns alle wieder mühelos als der gekreuzigte Christus.
So sensibilisiert entdecken wir uns selbst auch in Landschaften. Wir verstehen es, Verletzungen der Natur als eigene zu fühlen - das Bild offener Erde wirkt auf uns manchmal wie die Verletzung der eigenen Haut. Hier findet sich auch eine Wurzel unseres geradezu körperlichen Ekels vor der heute so oft beklagten "Umweltzerstörung". Wir verstehen sie ganz direkt als Verletzung des eigenen Ichs - dabei reagieren wir - wie ich in der Szene mit der Postkarte und dem Fresco im Tempel des Malatesta - erstaunlicherweise oft sehr viel empfindlicher auf Bilder, als auf die Wirklichkeit selbst, so als würde nur mit Bildern diese emotionale Übertragung richtig funktionieren. In Bitterfeld haben die Menschen jahrzehntelang gelebt und gearbeitet, ohne ihr Leben als allzu ungewöhnlich zu empfinden, erst als die Bilder kamen, hat sich ihr Elend ins Unerträgliche verschoben. KZ-Wärtern sollen bei Bildern der Resultate ihrer Gewalttaten die Tränen gekommen sein, die sie im Moment der Tat nicht empfanden. Ich selbst könnte wahrscheinlich leichter jemanden umbringen, als das Bild davon ertragen. Und dies scheint mir keine Frage des Gewissens zu sein, nein, an genau dieser eigenartigen Schizophrenie kann man die Signatur einer bildproduzierenden Kultur erkennen.
Vielleicht reagiert eine katholische Kultur nicht ganz so extrem, denn dort hat das Heiligenbild als Kitsch noch reale Bedeutung und braucht sich nicht in subtilen Übertragungen zu verwandeln. In bilderlosen Kulturen jedenfalls scheint kaum jemand so zu reagieren. In Ägypten zum Beispiel staunte ich über die endlosen Müllhaufen neben den Straßen in der Wüste, ich konnte mir nicht vorstellen, wie Abfall so sorglos und in solchem Maßstab direkt neben die Straßen geworfen wird und so die Landschaft verschandelt - ich weiß wovon ich rede, denn auch in meiner eigene Wohnung herrscht ein unglaubliches Durcheinander, dessen ich nicht Herr werden kann, weil ich es einfach nicht richtig wahrnehme. Nein, die Wüste ist nicht mehr so sauber, wie man sie sich als Jugendlicher vorgestellt hat. Auch der Schmutz im Nildelta hat entsetzliches Ausmaß, obwohl die Menschen im Inneren ihrer Wohnungen nicht weniger reinlich sind als hier. Aber anscheinend gibt es dort nicht die Art Blick, der aus Land ein Bild macht, mit dem man mitfühlen kann oder sogar muß. Bilderlose Kulturen erzeugen solchen Blick möglicherweise nicht. Das Land bleibt in ihnen bloßes Terrain, und weil man kein Selbstporträt in ihm entdecken kann, gibt es auch kein Mitgefühl mit Landschaft. Müll und Dreck, die einen nicht direkt betreffen, werden gar nicht erst gesehen. Dennoch wirkt das inzwischen menschlicher auf mich als vieles, was - vor allem im Fernsehen - in letzter Zeit im mitempfindenenden Modus geboten wird.
Das Fürchterlichste, was ich in dieser Art erinnere, ist das Bild einer jungen Katze, welche sich, von einer jungen Frau aus einem vollkommen verdunkelten Käfig genommen, dankbar und erwartungsfroh an sie anschmeichelt, offensichtlich erfreut, aus dunkler Ödnis gewissermaßen, ins Leben gefunden zu haben - das Marienbild samt kleinem Christus par excellence. Die junge Frau streichelte die Katze auch entsprechend liebevoll und gab ihr dann, das war Sinn dieser Einstellung, eine Spritze, auf Grund derer das Tier innerhalb von zwanzig Sekunden verendete; ein Tierversuch mit dem Ziel, herauszufinden wie Gehirngewebe sich durch einen kurzen visuellen Reiz, den einzigen im Leben der Katze, verändert. Zu diesem Zweck wurden Augenpartie und der Bereich, in dem man das Sehzentrum vermutet, anschließend aufgeschnitten, per Elektronenmikroskop untersucht und mit den Resultaten variierter Versuchsanordnungen verglichen: auf diese Weise hofft man, einem Verständnis des im Gehirn ablaufenden Sehprozesses näher zu kommen, brutal und hilflos, keine Frage, doch den Wissenschaftlern fällt bei ihren Diplom- und Doktorarbeiten nun einmal nichts besseres ein, und über den Sehprozeß und die tatsächliche Aufbewahrung des einmal Erblickten im Gehirn - das immerhin weiß ich - ist auch heute nicht viel mehr bekannt als zur Zeit Lukrezens oder des Heiligen Augustinus. Im Kern - auch allerfeinst daherkommende biochemische Untersuchungen haben daran wenig zu ändern vermocht - kaum etwas, was über Selbstbeobachtung und plausible Extrapolation hinausgeht. Furchtbare Sache. Der Film, dem die Bilder entstammten, wurde gemacht, um gegen Tierversuche zu polemisieren, für einen 'guten' Zweck also, die Polemik seiner Autoren war jedoch derart auf rhetorische Effizienz hin angelegt, daß man danach überhaupt nichts mehr wußte, denn man wurde hilfloses Opfer eines zynischen Spiels, in dem es objektiv nun einmal keine einfachen Antworten gibt. Die Autoren gaben einem natürlich welche, sie behaupteten einfach, in ihrem Besitz zu sein, daher nahmen sie sich auch das Recht, die Aufnahmen so zu drehen, daß das Leiden der Kreatur eine Heiligkeit bekam, die ihm nie und nimmer angemessen sein konnte. Drei Wochen später sah ich die gleichen Leute in einem anderen Film die Bundesregierung angreifen, weil nicht genügend Mittel für die Suche nach einem Impfstoff gegen Aids bereitgestellt wären - wollten sie einen solchen statt an Tieren an uninfizierten Menschen testen? Bestimmt wohl nicht an sich selbst. Es steckte eine Verlogenheit hinter diesem Film, die mit blind manipulierender Ästhetik zu tun hat und so prinzipiell war, daß meine ohnmächtige Wut darüber fast grenzenlos wurde und jetzt gehe ich vom ich zum Er über, weil ich das Gefühl habe, mich nur so gegen Verbrecher diesen Typs schützen zu können:
"Es schüttelte ihn, immer wieder, wenn er an die Bilder dieser Katze dachte - wie einem Tier sträubten sich ihm dabei die Nackenhaare, denn er fühlte sich hier ganz dicht an etwas, das mit ihm, mit ihm allein zusammenhing, gar nicht mal so sehr mit diesen Tierversuchen. Da war irgendwas, das hatte mit seiner toten Mutter zu tun und - und diese Journalisten oder was sie waren, die ganze Bande, die spielten da mit unverstandenen Ur-Erfahrungen, und zwar auch seinen, und verwandten sie für eine zynische Politik, bei der es - um was eigentlich überhaupt ging? Er vermochte es nicht zu sagen. Nicht jedenfalls, so schäbig war das leider nicht, primär um Geld, es ging eher um Anerkennung, einerseits in einer nicht recht greifbaren Öffentlichkeit, mehr aber wohl von Kollegenkreisen, vielleicht auch noch um einen Fernsehpreis. Unverantwortliche Saubande! empörte er sich und mußte weinen, wie er an die, als sie das Licht der Welt zum ersten Male wahrnahm, vertrauensvoll blickenden Augen der Katze dachte, und er weinte und weinte und verlor jedes Gefühl für die vergehende Zeit.
Aber während er das vor sich hin rekonstruierte, ging ihm ein Abschnitt bei Cicero nicht aus dem Kopf, in dem Kummer schlicht eine 'Leidenschaft' genannt wurde, der man nicht einmal im Ansatz verfallen dürfe. Dabei galten als Ursache derart verfehlten Kummers nicht bloß Affekte wie Neid, Eifersucht, Ärger, Jammern, Mißgunst - da konnte er Ciceros tusculanischem Gespräch noch folgen - sondern es zählten auch eher liebenswürdige Äußerungen des Menschlichen dazu: Leid und Mitleid, Sorge, Besorgnis, Grübeln, Schmerz und jede Form von Traurigkeit oder ähnlich gearteter Niedergeschlagenheit. Sehr lustig muß es gewesen sein, das Leben in der Antike, dachte er, wenn den Menschen gelungen war, all diese Formen von Kummer schon im Ansatz zu ersticken. Und dann geriet er beim Denken an wieder das Kamerateam, das den Katzenfilm produzierte, erneut in Wut: sie hatten alles schon vorher gewußt, Kameramann, Beleuchter, Regisseur, Produzent, Produktionsassistent, selbst die Wissenschaftlerin, man hatte ausgeleuchtet, ideale Aufnahmewinkel gesucht, war ja keineswegs zufällig am Ort des Geschehens gewesen; nein, es war alles geplant, 'Profis' eben; schließlich wurde der Wissenschaftlerin gesagt:
"Nun machen Sie mal!" Und dann hatte sie es gemacht: es
wurde gedreht, anschließend geschnitten und das Ganze schließlich
'professionell' mit kitschig-klassischer Musik unterlegt, um das äußerste
aus den Bildern herauszuholen. Vermutlich hatte die Wissenschaftlerin sich
zu Tode geschämt, sobald sie das Resultat ihres Handelns im Film sah,
war womöglich gleich danach aus dem Fenster gesprungen, weil dieses
optimierte Bild ihrer Unmenschlichkeit ihr unerträglich gewesen sein
mußte - dabei war Menschlichkeit in solchem Zusammenhang das unpassendste
Wort. Philipp überfiel kalte Wut, wenn er an dieses Filmteam dachte:
"Geil, das wird was; da werden wir was in Bewegung setzen!" Und
dann wurde durch das Senden des Films mit seinem Kummer gespielt, da wurde
er unversehens getroffen, wo er am meisten zu verletzen war. Säue waren
das (in seiner Hilflosigkeit wußte er nicht, wie sonst er sie beschimpfen
sollte), er hätte nicht übel Lust, den Verursachern seiner Wut,
diesen 'Profis', das gleiche anzutun, was sie jener Katze angetan hatten.
Nun gut - an diesem Punkte wollen wir erst einmal aufhören. An sich müßten wir jetzt noch andere Muster untersuchen, die einen beim Sehen von Bildern zum Weinen verleiten, den Vater Sohn Konflikt, das Kain und Abel Muster, das große Begräbnis und ähnliches, aber dazu fehlt jetzt die Zeit. Die Verwandlung von Selbstmitleid in Mitgefühl, die den meisten zugrunde liegt, ist jedenfalls hochinteressant. Seine Fatalität steckt vor allem in seiner Maßlosigkeit. Vielleicht ist es so maßlos, weil es für viele von uns das einzige über uns selbst hinausgehende Gefühl ist. Es ist völlig unquantitativ, und genau das Un-, ja sogar ausgesprochen Antiquantitative ist der entscheidende Defekt bildbasierender Denkweisen. Details können den Weltüberblick nicht ersetzen, aber genau das passiert: zu groß ist das Entsetzen über den eigenen Fall. Wollte ich meinem Impuls nach dem Betrachten der Bilder des fallenden Vogels folgen, müßte ich alle Steilküsten der Welt einreißen und würde so ein Unheil anrichten, das keinerlei Relation zu dem zu reparierenden Defekt hat - als erstes würde ich dabei wahrscheinlich diese Spezies Vogel ganz ausrotten. Und ich würde es nur tun, und das ist der Punkt, um von solchen Bildern nicht mehr belästigt zu werden, das ist das moralisch Bedenkliche. Das Spiel mit dem Mitgefühl taugt nichts bei der Umsetzung in Politik.
Man kann erkennen, wie man von hier zu dem im Ölschlick verendenden
Vogel gelangen kann, der einen mehr rührte als die Bilder von tausenden
bei einer Überschwemmungskatastrophe umgekommenen Menschen, oder wie
das erstaunliche Mitgefühl mit zerbombten Ruinen entsteht, weil man
in sie seine eigene Zerrüttetheit projiziert. Interessant wäre
auch zu untersuchen, inwieweit der kategorische Imperativ Kants und die
daraus entstandene Sozialdemokratie als direkte Folge des protestantischen
Bilderverbots begreifbar sind - weil nämlich das Fehlen von Bildern
in den Kirchen einen derartigen Mangel an Mitgefühl entstehen ließ,
daß er verbal oder in gesetzgeberischen Akten kompensiert werden mußte.
Vielleicht ist das aber auch nicht wirklich interessant, solange ihm die
belletristische Verankerung fehlt, die das selbstgestaltete Leben ausmacht.
Das spürte ich jedenfalls deutlich, als ich mich bei der Beschreibung
der verschiedenen Rahmungen des Donatellos
in meinem Arbeitszimmer umdrehte und mir ein Bild von mir selbst an der
Wand auffiel, das ich lange nicht - vielleicht sogar noch nie - sorgfältig
betrachtet hatte. Und das soll ein kurioser und angenehm banaler letzter
Beitrag in der Komödie um unser Thema: "Was sehen wir eigentlich
in den Bildern" sein. Es hat den Titel "Drying Maccaroni in the
Streets of Naples".
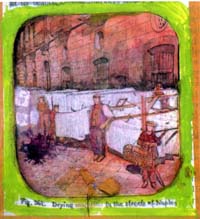
Der Titel steht unterhalb des eigentlichen Bildes einer fünf mal
sechs Zentimeter großen Straßenansicht von Neapel, in der Maccaroni
wie Wäsche auf einer Leine zwischen den Häusern getrocknet werden.
Das Bild ist eine von mir kolorierte Photokopie eines Stiches aus einem
alten Geographiebuch, und eigentlich nur interessant, wenn man weiß,
daß ich das Bild 1970 kurz nach meinem ersten Nervenzusammenbruch
gemacht habe - in dessen Zentrum standen nämlich Spaghetti. Wie alle
Nervenzusammenbrüche war auch dieser eine recht komplizierte Angelegenheit,
die ich jetzt nicht weiter erklären möchte, zur Unterhaltung möchte
ich aber ein paar der Ingredienzien aufzählen, mit der die Spaghettisoße
angerührt war: erstens natürlich ein Spaghettitrauma aus frühester
Kindheit, dessen Struktur mir bis heute nicht ganz klar ist, zweitens an
diesem Abend gegessene Spaghetti mit drittens einer Exfreundin, die viertens
besoffen danach im Nebenzimmer mit fünftens einem guten Freund von
mir gut hörbar schlief, während ich sechstens allein mit einer
Geschlechtskrankheit bei siebtens gerade begonnenem Rauschgiftentzug in
achtens einem fremden Zimmer, weil ich kein eigenes mehr hatte, nach neuntens
dem Lesen von Lenins Testament nach dem zehntens dreimonatigen Versuch in
einer kommunistischen Splittergruppe Stalin anzubeten, nachdem elftens mir
ganz klar geworden war, daß künstlerische Produktion in unserer
Zeit das allererbärmlichste bourgeoise Schmarotzertum repräsentiert,
das man sich überhaupt vorstellen kann, und genau dem hatte ich mich
verschrieben. Elf gute Gründe also durchzuknallen, ihre Kombination
machte sie unwiderstehlich - so knallte ich eben durch. Nun - auch das ist
mäßig interessant.

Interessant ist aber, wie ich, ohne die geringste Ahnung gehabt zu haben,
was ich da eigentlich tat, das Bild danach bearbeitete. In der Mitte hängt
also dieser helle Streifen Maccaroni, die Häuser darüber und die
Straße sind rosa koloriert und darum herum ist ein nach innen abgerundeter
grüner Rahmen gemalt. Dadurch sieht die Szene ein wenig wie ein Fernsehbild
aus. Unterhalb des Bildes befindet sich noch in dem grünen Rahmen der
Titel "Fig 165 Drying Maccaroni in the Streets of Naples".
Um den grünen, nach außen rechteckigen Rahmen gibt es einen 3mm
starker Streifen dunkelbraunen Klebebands, der eine weitere Rahmung andeutet.
Das Ganze ist aufgeklebt auf ein größeres Stück hellbraunes
Papier, das wiederum von einem Passepartout aus braunem Karton gefaßt
ist, dessen Innenkante ein schmaler weißer Streifen ist, und dessen
Fläche aus braunem Karton besteht. Das Passepartout ist in einen schwarzen
Holzrahmen gefaßt, auf dessen Innenseite sich eine schmale vergoldete
Leiste befindet. Das Ganze ist unter Glas und hängt an einer hellen
rechteckigen Wand, die eine weitere Rahmung bildet. Wenn ich daran denke,
daß mich vor allem Dingen die Maccaroni - und nicht einmal die, sondern
die durch sie maskierten Spaghetti - an dem Bild interessiert haben, dann
habe ich, um dem Bild eine fertige Gestalt zu geben (die mir immerhin so
gut zu sein schien, daß es jetzt in meinem Arbeitszimmer hängt,
und ich wiederhole, bis heute, wo ich mir die Rahmung des Donatellos genauer
angesehen habe, hatte ich keine Ahnung, was eigentlich mit dem Bild los
war), habe ich also nicht weniger als 9 Rahmungen um dieses Zentralereignis
gelegt - um es in Zaum zu halten oder zu beschwören oder wie sonst
man es nennen soll, dazu als zehnte eine Verwandlung der Spaghetti in Maccaroni
und eine Schrift, die ausdrücklich erklärt, daß es sich
um Maccaroni handelt und nicht um Hamburg, wo ich den Zusammenbruch hatte,
sondern um Maccaroni in Neapel, und dazu gibt es als elftes noch eine Zahl
Figur 185, die bestätigt, daß es hier ganz wissenschaftlich zugeht,
und im Grunde nichts mit mir zu tun hat, sondern daß es sich um einen
ganz gewöhnlichen Fall unter Tausenden handelt, und so war es ja auch.
In wunderschöner Entsprechung zu den elf Gründen, die das Ereignis
verursachten, gibt es darum herum also elf Rahmungen, und heute erkenne
ich hier die Wurzeln einer fixen Idee, die über mancherlei Unsinn schließlich
zu dem heutigen Abend geführt hat, und nach dem Motto: durch die Neurose
zur Wahrheit, einer Beschreibung von Madonnenbildern.

Inzwischen esse ich Spaghettis wieder ganz gern und kann den Ekel, den ich einmal bei schon ihrem Anblick empfand, nicht mehr nachempfinden. Irgendwie habe ich dies Ereignis bewältigt. Warum aber habe ich das Bild überhaupt aufgehängt? Warum in meinem Arbeitszimmer und nicht über meinem Bett? Vermute ich eine Verbindung zwischen meiner Kreativität und diesem Nervenzusammenbruch? Denke ich, daß in diesem Ausbruch die Ursache von etwas zum Vorschein gekommen ist, das eine Art kreativer Zwanghaftigkeit in mir hat entstehen lassen? Meine ich, daß es in mir ein Kindheitstrauma gibt, das sich in irgendwas verwandeln wollte, und nur durch diese Art von Zusammenbruch in den künstlerischen Bereich gelenkt wurde? Glaube ich, daß ich sonst mit ähnlicher Energie so etwas wie Raketenmotoren hätte bauen müssen? Die Ursache des ursprünglichen Traumas blieb mir bis heute verborgen. Im übrigen muß ich zugeben, daß in meinem Arbeitszimmer auch eine Reproduktion der Mona Lisa hängt - ungerahmt allerdings, und das bringt uns zum allerletzten Teil des Abends.
Wie kam die Mona Lisa in mein Arbeitszimmer? Ich muß daran denken, daß sie und ihr Lächeln wahrscheinlich in Millionen von Haushalten hängen - sicher wäre ganz komisch, eine Anthologie darüber zusammenzustellen, wie die Menschen zu ihr kamen. Bei mir begann es mit Onkel Willi. Onkel Willi hatte ihre letzten Jahre mit seiner Mutter, meiner Großmutter verbracht. Nach ihrem Tod blieb er in der Wohnung und lebte von da an allein. Einmal sagte er mir, er könne die Tapeten dort nicht mehr ertragen - wenn er von der Arbeit nach Hause kam, würde ihn das Muster der Tapete anstarren und sich in Fratzen verwandeln, die ihn auslachten. Von einer Neutapezierung wollte er freilich nichts wissen. Die Wohnung bestand aus einem Wohnzimmer, einer Küche, einem Schlafzimmer und einem kleinen Zimmer, in dem er wohnte, während meine Großmutter noch lebte. Einmal bemerkte ich eine Veränderung: er war in Paris gewesen und hatte eine kleine Mona Lisa mitgebracht, die hing nun in dem kleinen Zimmer über seinem Bett. Danach beklagte er sich nicht mehr über die Tapete. Inzwischen habe ich erfahren, daß er nach dem Tod seiner Mutter ihr Schlafzimmer nicht verändert hatte und weiter in dem Kinderzimmer schlief. Ich nehme an, er hat das inzwischen geändert, aber wenn ich es mir genau überlege, warum sollte er eigentlich? Ich glaube nicht, daß es lächerlich ist, den Tod seiner Mutter so sehr zu betrauern, daß man sogar Räumlichkeiten mit einem gewissen Respekt behandelt. Als ich die auf einem kleinen Holzstück aufgeklebte Mona Lisa über seinem Bett im Kinderzimmer sah, wollte ich merkwürdigerweise genau so ein Bild haben, mochte ihn aber nicht darum bitten. Ich spürte, daß seine Versöhntheit mit der Tapete mit diesem Bild zuammenhing.
Also wollte ich selbst eins kaufen. Es stellte sich heraus, daß gar nicht so leicht war, eine kleine Mona Lisa zu bekommen. Einmal fand ich ihr berühmtes Lächeln auf einem Teller, aber ich wollte, wie Sie inzwischen vielleicht verstehen, meine Mona Lisa auf einem Rechteck. Letzten Frühling fuhr ich selbst nach Paris, um zu versuchen, den Film, von dem Sie zu Anfang einen Ausschnitt gesehen haben, auf dem Festival in Cannes unterzubringen. Inzwischen war meine Mutter ebenfalls gestorben. In Paris gab es alles mögliche: T-Shirts mit Mona Lisas, Bierkrüge, ganze Eßgeschirre, nur keine auf einem kleinen Rechteck. In einem Laden wurden lebensgroße Kopien angeboten, aber ich wollte eine kleine. Nun, mein Film wurde von dem Festival nicht genommen (They were not impressed, sagte man meinem Agenten), aber dann fand ich doch noch ein kleines rechteckiges Stück Holz mit einer aufgeklebten Mona Lisa. Eine Stunde lang dachte ich tatsächlich, es hätte sich gelohnt, vier Jahre an einem Film zu arbeiten, um dafür eine derartige Mona Lisa zu bekommen.
Aber wo sollte ich sie zu Hause hinhängen? Über meinem Ehebett
empfand ich sie als unpassend, ich war mir sicher, daß meine Frau
das nicht akzeptieren konnte. Auch auf dem Flur schien das Bild unakzeptabel,
ich hatte Angst vor spöttischen Bemerkungen meiner Freunde. So kam
es ins Arbeitszimmer, nicht in der Mitte einer Wand natürlich, sondern
exzentrisch und unauffällig etwas oben. Wo jetzt das Bild mit den trocknenden
Makkaronis hängt, hing damals ein altes Bild von Emigholz, auf dem
Palmen in einem raffinierten Gittermuster aufgetragen waren. Wenn ich arbeitete,
saß ich an meinem Schreibtisch vor zwei Fenstern. Rechts hinter meinem
Rücken hing dieses lächelnde Holzstück. Durch die verschämte
Hängung entstand ein Leerraum an der Wand, in den eigentlich etwas
gehörte. Im letzten Sommer brachte ich aus Italien ein Stück Papier
mit einem Bild aus einer mittelalterlichen Handschrift mit. Es hieß
"Desiderius übergibt dem Heiligen Benedict seine Bücher und
seinen Besitz". Ich nahm damals an, Desiderius wäre ein römischer
Kaiser - das Bild ist im übrigen zu kompliziert, um es heute abend
noch angemessen zu beschreiben, seit letzten Sommer hängt es jedenfalls
schräg unter der Mona Lisa in meinem Arbeitszimmer.

Dann beschleunigten sich die Ereignisse. Meine Ehe löste sich auf, naturgemäß entstand dabei ein Durcheinander in meiner Wohnung. Ich vermietete das Wohnzimmer und zog in das Zimmer meiner Frau. Einen Moment überlegte ich, ob ich jetzt die Mona Lisa über meinem Bett aufhängen könnte, ließ es dann aber sein. Ich bin ein eher konservativer Mensch und hänge an einer gewissen Stabilität, vielleicht ist konservativ auch nicht der richtige Ausdruck - ich habe die überstarke Neigung, nun einmal entstandene Situationen zu akzeptieren. Anstatt sie energisch so zu verändern, daß sie meinen Vorstellungen entsprechen, versuche ich, mich in ihnen zurecht zu finden. Irgendwie scheint mir das eine lebensnähere Existenz zu ermöglichen als die Verfolgung an sich vernünftiger Pläne. Die Bilder aus meinem alten Wohnzimmer paßten jedenfalls nicht an die Nägel, die meine Frau vor ein paar Jahren in ihrem Zimmer angebracht hatte. Weil ich keine neuen Nägel einschlagen wollte, mußte ich ein paar meiner Bilder wegpacken. Dabei blieb ein Nagel übrig, für den ich auf einmal kein passendes Bild hatte, das Bild von Emigholz paßte jedoch genau dorthin.
Jetzt war allerdings im Arbeitszimmer, wo der Emigholz gehangen hatte,
ein Nagel frei. Von den Bildern, die ich mochte, schien keines dorthin zu
passen. In einer Abstellkammer fand ich die trocknenden Maccaroni. Ich staunte,
daß ich das Bild nicht weggeworfen hatte, ich fand es schon immer
schlecht. Weil ich im Augenblick kein anderes hatte, hing ich es probeweise
auf, widerwillig, denn wie Sie sehen können, ist es wirklich nicht
schön. Aber fürs Arbeitszimmer, dachte ich, könnte es gehen.
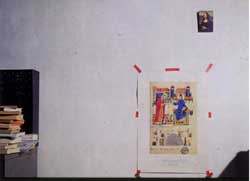
Und so hängt hinter mir, wenn ich arbeite, dieses merkwürdige Bildensemble - ein rechteckiges Stück Holz mit Mona Lisa schräg über einem Desiderius, der seine Bücher und seinen Besitz dem Heiligen Benedict überschreibt und auf der anderen Wand elffach gerahmt trocknende Makkaroni. Der Zusammenhang zwischen ihnen war mir schleierhaft. Erst heute weiß ich, was sich dahinter verbirgt: natürlich entdecke ich nun hinter dem Lächeln der Mona Lisa das Lächeln im Gesicht meiner Mutter, die mich in die Welt hinausgeschickt hat, ohne daß ich je verstand warum. Um Raketenmotoren zu bauen wahrscheinlich oder um Versicherungsvertreter zu werden, ich weiß es nicht. Nur der glückliche Umstand eines Nervenzusammenbruchs verwandelte das in einen menschentsprechenderen Auftrag. Das Bild mit Desiderius und dem heiligen Benedikt gibt dem so etwas wie geschichtliche Substanz. Irgendwie glaube ich, daß weltliche Macht sich immer dem empfindenden Geist wird übergeben müssen, weil sie irgendwann einfach nicht mehr weiß, wohin sie sich entwickeln soll. Es handelt sich um eine Art freiwilliger Kapitulation, die vollzogen werden muß, wenn Verwaltung sich nicht in den Irrsinn hineinbewegen will. Ich weiß nicht einmal, ob der empfindende Geist dem auch nur im Entferntesten gewachsen sein wird - der heilige Benedikt war es sicher nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das richtig oder begrüßenswert ist, aber das Lächeln meiner Mutter (eigentlich bin ich damals ja aus freien Stücken gegangen, das ist mir aber nicht recht mehr bewußt) verwandelt dies in der Mona Lisa zu einer Art Gewißheit, und die trocknenden Maccaroni leuchten auf eine Art Grund. Zweifellos wäre sie mit mir zufriedener gewesen, wenn ich Raketenmotoren zusammengebaut hätte, aber ich hatte ja keine Wahl.
Und noch eins: genaugenommen handelt es sich bei diesem Ensemble gar
nicht um drei Bilder. In dem gleichen Sinne, in dem wir Giottos Ausmalung
der Scrovegnikapelle ein einziges Bild in Form einer Kirche genannt haben,
sind sie Teil eines einzigen Bildes in Form eines Arbeitszimmers. In ihm
sind die Einzelstücke nicht weiter wichtig, sie können ruhig armselig
sein, was zählt ist der Zusammenhang. Aber auch der ist relativ unwichtig
und spielt sich neben oder sogar im Rücken des eigentlichen Geschehens
in Arbeitszimmer und Kirche ab. In beiden geht es im Grunde ja nicht um
die Wahrheit sondern um etwas viel Ernsthafteres, es geht um das eigentlich
wesentliche Geschäft im Leben, es geht - um die Vergebung der Sünden.

Nun - das klingt vielleicht etwas obskur, aber die Gnade, sagt der heilige
Augustinus, fällt unvorhersehbar über die Menschen: keiner weiß,
wen Gott schließlich mit seiner Gnade auszeichnen wird. Er ist uns
unergründlich und seine Gnade regnet vom Himmel herab wie das Gefallen.
Auch das, sagt Kant, fällt uns einfach zu, wir wissen nicht, warum
uns etwas gefällt. Über das Gefallen haben wir heute abend immerhin
einiges herausfinden können, aber bei der Gnade und ob uns die Gnade
begegnen wird, gelingt einem das nicht.
Ich jedenfalls möchte mit einem Anklang an den Schluß des
Don Quijote schließen, der am Ende seines Weges nicht mehr Don Quijote
de la Mancha heißen wollte, sondern wieder Alonso der Gute, der er
einmal war, bevor er zuviel Ritterromane gelesen hatte, und als Alonso der
Gute möchte ich mich für Ihre Geduld bedanken und wünsche
Ihnen einen schönen Abend.
Bellini Madonna von der Wiese (National Gallery London)
VIDEO FILM Ausschnitt aus DAS OFFENE UNIVERSUM
KAMERA Postkarte vom Tempel des Malatesta
KAMERA Postkarte vom Bogen des Augustus
KAMERA Tempel des Malatesta
Piero de la Francesca: St. Sigismund und Sigismondo Malatesta
POSTKARTE DAVON HALTEN
Giotto: Kruzifix im Tempel des Malatesta (Schrägansich)
Der Tempel als Dia
Lippi: Verkündigung (National Gallery London)
KAMERA: Donatello: Maria mit Kind (Museum Dahlem)
Donatello: Maria mit Kind
KAMERA Postkarte Sonnenuntergang
KAMERA Postkarte Castellamare
Kamera Bellini
Giotto: Innenansicht der Arena Kapelle
Ravenna:Innenansicht einer Längswand von S. Apollinare Nuovo
Ravenna: Innenansicht der Apsis vom S. Apollinare in Classe
David: St. Nicholas dankt Gott für seine Geburt (Scotish National Gallery Edinburgh)
KAMERA Maestro del Bambino Vispo: Verkündigung (Doppelbild, Städelmuseum Frankfurt)
Kamera: Botticelli Rundbild
Bellini: Madonna von der Wiese
Schongauer: Die Peinigung des Heiligen Antonius
El Greco: St. Jerome in Penitence (National Gallery Edinburgh)
Piero: Die Geburt Christi (National Gallery London)
Kamera 3 Spanierinnen
Kamera Pouissin
Ucello: Schändung der Hostie (Museum Urbino)
Ucello: Detail aus der Schändung
Piero: Geißelung Christi (Museum Urbino)
IN PIERO BUCH BLÄTTERN
Piero: Detail der Verkündigung vom Altar des St. Antonius
KAMERA: Doppelbild Bambino Vispo
Crivelli: Verkündigung (Museum Dahlem)
Piero: Verkündigung aus Arezzo
Lippi: Verkündigung
Duccio: Verkündigung (National Gallery London)
Verkündigung aus dem Stundenbuch des Lorenzo di Medici
KAMERA Duccio: Verkündigung
KAMERA Lippi: Verkündigung
Donatello: Maria mit Kind
Giotto: Kruzifix frontal
Bellini: Modonna mit Kind vor grünem Vorhang (National Gallery London)
KAMERA Donatello Maria mit Kind
Drying Maccaroni Detail
Drying Maccaroni mit allen Rahmungen
Bellini grüne Madonna
KAMERA Bellini grün
Desiderius übergibt dem Heiligen Benedikt seinen Besitz (Vatikanmusum)
Bellini: Madonna von der Wiese